Bücher
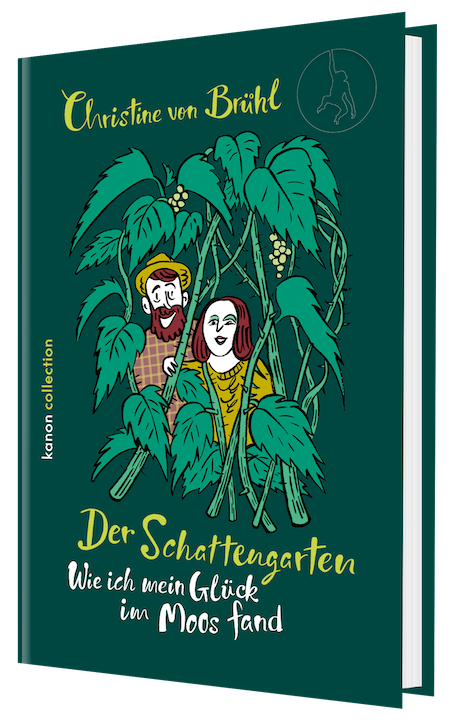
Der Schattengarten
© Kanon Verlag Berlin GmbH 2025
Bestellen über den kanon verlag
I never promised you a rose garden!
Ihre Kindheit hat Christine von Brühl im feinen Londoner Hyde Park verbracht. Sie kann Schnittlauch nicht von Unkraut unterscheiden, interessiert sich nicht für Obsternte und selbstgemachte Marmelade.
Anders als ihr Mann. Er liebt genau das. Und eines Tages verkündet er froh: Wir haben jetzt einen Garten. Hyde Park oder Versailles? Weit gefehlt: Mitten im Kyffhäuser!
Christine von Brühls Mann hat ein verwildertes Grundstück im Wald entdeckt und möchte darauf einen Garten anlegen. Das Gelände ist unwegsam und düster, es gibt weder Wasser noch Strom. Dafür aber Brennnesseln. Christine vom Brühl fühlt sich verloren und fremd. Ihr Mann gewinnt Regenwasser vom Dach und leitet es ins Haus. Sie bewaffnet sich mit Gießkanne und Gummistiefeln und gießt eigenhändig die Rhododendren. Das Projekt ist zu einem gemeinsamen geworden. Aber plötzlich taucht ein neuer Gegner auf. Als wären Trockenheit und fehlendes Licht nicht schon genug. Er ist mächtig, er ist der kosmische Antagonist des halbschattigen Gärtnerpaares: die Wühlmaus. – Eine Geschichte voller Naturverbundenheit, Widerstandswillen und Beziehungssinn. Genial illustriert von Teresa Habild. Für alle Halbschattengewächse.
Noch nicht verfügbar

Schwäne in Weiß und Gold. Geschichte einer Familie
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2021.
Bestellen über den Aufbau Verlag
Christine von Brühl erzählt das wechselvolle Schicksal ihrer Familie. Am Beginn stehen Heinrich Graf von Brühls märchenhafte Karriere am Dresdner Hof und sein beispielloser Niedergang. Es folgen die Wirren von Krieg, Flucht, Vertreibung und Wiedervereinigung. Die Geschichte ist dabei aufs engste mit dem Brühlschen Schwanenservice verbunden. Es stammt aus der Manufaktur Meissen und war das erste Porzellan von derart gestalterischer Pracht. Seine Fragilität ist von höchster Symbolkraft. Still glänzten die Schmuckstücke an den Wänden, dekorierten die Tafel bei Hochzeiten und anderen familiären Höhepunkten. Den Rest des Jahres wurden sie sorgsam in Schränken und Vitrinen verwahrt. Denn bei aller Pracht der Terrinen und Kandelaber, Tassen, Teller und Fingerschalen umgab die wertvollen Exponate stets eine Zerbrechlichkeit, die eine besondere Verpflichtung bedeutete. Bis heute ist die Familie ihr treu geblieben. Nach Kriegen und Flucht sind heute von ursprünglich 2000 wertvollen Teilen nur noch wenige erhalten. 27 kostbare Exponate wurden der Dresdner Porzellansammlung auf Dauer entliehen und werden heute prominent im Zwinger präsentiert. Dank Frieden und Mauerfall ist der Familie damit die Übertragung ihrer tradierten Werte in zeitgemäße Formen gelungen. Eine persönliche, mitreißende Geschichte von europäischen Ausmaßen.
Die Geschichte meiner Familie geht zurück auf Heinrich Graf von Brühl (1700–1763), erst Page und später Minister am Hof des sächsischen Kurfürsten August II. (1670–1733), genannt „der Starke“, und seines Sohnes Friedrich August II. (1696–1763), bezeichnet als August III., beide während ihrer Regierungszeit gleichzeitig Könige in Polen. Hoch geschätzter Diplomat und Staatenlenker einerseits, verhasst und verleumdet wegen seiner dauerhaften Nähe zur Macht andererseits, polarisierte Brühl jahrhundertelang die Ansichten. Priesen die einen seine klugen Strategien im Dienst Sachsens, neideten die anderen ihm seine Karriere und bezeichneten ihn als intrigant und unaufrichtig. Lobte man auf der einen Seite sein Repräsentationsvermögen und seine kostbaren Kunstsammlungen, mokierte man sich auf der anderen über seine Verschwendungssucht und gab ihm die Schuld an der finanziellen Misere des Landes. In Vergessenheit geriet er nicht: Die nach ihm benannte Brühlsche Terrasse, Reminiszenz seines Anwesens in unmittelbarer Nähe der kurfürstlich-königlichen Residenz, dominiert bis heute die Stadtkulisse von Dresden.
Insbesondere der Unwille Friedrichs II. von Preußen (1712–1786) gegen Brühl bestimmte das Bild, das sich Historiker wie Kulturwissenschaftler von ihm machten. Ausgerechnet auf die von ihm geprägte preußische Geschichtsschreibung berief sich die Mehrzahl der Beobachter jener Epoche und erklärte den Minister zu einer unliebsamen Figur. So stellte der ungarische Historiker Aladár von Boroviczény 1930 in seiner Biographie erstaunt fest: „Bei der Durchsicht der sehr umfangreichen Literatur über den Grafen Brühl begegnete ich zu meiner Überraschung bloß abfälligen Urteilen über den Mann, der soviel für sein Vaterland geleistet hatte, wie kaum je ein Mensch vor ihm. Und als ich an die unmittelbaren Quellen kam, fand ich nicht eine einzige historisch begründete Tatsache, welche das landläufig ungünstige Urteil über den sächsischen Premierminister rechtfertigte.“
Nicht nur die Geschichtsschreibung folgte der preußischen Sicht auf das augusteische Zeitalter, auch der polnische Autor Ignacy Kraszewski (1812–1887) beschrieb den sächsischen Hof in seiner Sachsentrilogie Gräfin Cosel (1873), Brühl (1874) und Aus dem Siebenjährigen Krieg (1875) als Hort der Intrige und des Verrats. Die beiden Kurfürsten und Könige hätten Sachsen und damit auch Polen durch Unachtsamkeit und Misswirtschaft dauerhaft in den Ruin getrieben. Brühl sei ihnen dabei ein williger Helfer gewesen. Dank geschickter Ränkespiele und Betrügereien habe er sich das Amt des ersten Ministers erschlichen. Konkurrenten wie Minister Alexander Józef Sułkowski (1695–1762) oder den Hofbeamten Christian Heinrich von Watzdorf (1698–1747) habe er kurzerhand verbannen oder umbringen lassen.
Dabei war es wohl kaum Kraszewskis Absicht, Friedrich II. auf ein Podest zu heben, ausgerechnet den Mann, der mitverantwortlich für die Teilung Polens war. Der Romancier beschrieb diese Zeit vielmehr aus der Haltung eines Patrioten, der die Herrschaft der sächsischen Kurfürsten in seinem Land im Rückblick – seine Werke erschienen fast hundert Jahre später – kritisch sah. Naturgemäß hielt er sich dabei nicht fortlaufend an historische Fakten, vieles in seinen drei Büchern ist frei erfunden, aber sie lesen sich leicht und fanden rasch Verbreitung. Damit erreichte die einseitige Sichtweise ein breites Publikum und verankerte sich nachdrücklich in der allgemeinen Wahrnehmung.
Als ein Jahrhundert später DDR-Granden das Thema aufgriffen und eine sechsteilige Fernsehserie auf der Basis der Romane Kraszewskis produzierten, fühlte sich die Mehrheit in ihrer Ansicht bestätigt. Dabei war auch diesem Regime keinesfalls daran gelegen, die Privatkampagne Friedrichs II. gegen einen einzelnen sächsischen Höfling fortzusetzen. Genauso wenig hatten sie die Absicht, Polen gegenüber Sachsen oder gar der DDR aufzuwerten. Diesmal galt es, die Zeiten absolutistischer Prachtentfaltung zu verurteilen und die Vorzüge des Arbeiter-und-Bauern-Staats zu propagieren. Auch dazu eignete sich Brühl ausgezeichnet. Dargestellt als intriganter und aalglatter Vertreter seines Standes, der sich seine Stellung bei Hofe zunutze macht, um die Staatskasse an sich zu reißen und sich persönlich zu bereichern, spielte er eine eindrucksvolle Rolle in dem sechsteiligen Film Sachsens Glanz und Preußens Gloria. Die sorgenvolle Frage des Kurfürsten an seinen Untergebenen: „Brühl, habe ich noch Geld?“, die in dem Film mehrfach wiederholt wird, dazu die herausragende Figur des Schauspielers Rolf Hoppe, der den sächsischen Herrscher als nachgiebigen, sentimentalen König mimte, prägte sich den Zuschauern unauslöschlich ein.
1983/84 mit landesweit bekannten Darstellern in prächtigen Kostümen gedreht, mit Pferden, Kutschen und Reitern, an unterschiedlichsten Schauplätzen, auch außerhalb der DDR, wurde der Mehrteiler 1985 und 1987 erstmals ausgestrahlt und dann unzählige Male wiederholt. Auch an finanziellen Ausgaben wurde nicht gespart: Die Serie kostete laut der Sendung Umschau im Mitteldeutschen Rundfunk 21 Millionen DDR-Mark. Kaum ein Bewohner Sachsens oder Liebhaber der sächsischen Geschichte, der den Streifen nicht gesehen hätte.
Erst im 21. Jahrhundert wendete sich das Blatt allmählich. Unter dem Motto „Was vom Glanze übrig blieb“ begab sich der Journalist Jens Jungmann nach der politischen Wende in Europa auf Spurensuche und brachte viele bislang unbekannte Details über den Film ans Licht. Direktoren und Experten der Museen der Staatlichen Kunstsammlungen zu Dresden, des Sächsischen Hauptstaatsarchivs, der Schlösser und Gärten Sachsens, des Königlichen Schlosses in Warschau und des Wawel in Krakau standen ihm dabei hilfreich zur Seite. So gelang es ihm, an unzähligen Beispielen herauszuarbeiten, wie fehlerhaft die Darstellung der sächsischen Geschichte in der Filmserie war. Seine Recherchen fanden Eingang in zwei mehrteilige Artikelserien in der Chemnitzer Morgenpost und der Dresdner Morgenpost, die sich Einzelheiten und Hintergründen der Verfilmung widmeten. Wieder war das Interesse immens: Die Serien brachten den Zeitungen ein Auflagenplus von 25 Prozent.
Auch in der Wissenschaft war man seit der Wendejahre bemüht, ein differenzierteres Bild von Brühl und dem augusteischen Zeitalter zu zeichnen. Der Leipziger Historiker Walter Fellmann veröffentlichte 1989 eine Biographie über den Minister, der ihn als loyalen Untergebenen seiner Kurfürsten und als begabten Politiker seiner Zeit darstellte. Im Vorwort zur vierten Auflage schreibt er: „Einige Leser haben in meinen Aufzeichnungen das Stichwort ‚Brühlsches System’ vermißt, inzwischen als eine Art geflügeltes Wort verwendet. Ein ‚Brühlsches System’ im eigentlichen Sinne des Wortes hat es jedoch nie gegeben. Im spätabsolutistischen Sachsen sah sich der Herrscher als vom Gottesgnadentum beseelt: er war das Land, sein Wille Gesetz. Zur Schaffung eines ‚Systems’ war selbst der einflußreichste Minister außerstande. Zum ‚Systemgründer’ avancierte Brühl durch Zuschreibung von Macht, die er nie besaß. Daß noch heute die Auffassung vertreten wird, er sei seit dem Sturz Sulkowskis 1738 ‚für ein Vierteljahrhundert der unumschränkte Herrscher in Kursachsen’ gewesen […], verwundert schon. Der Kurfürst in seiner Gruft kann darob keinen Widerspruch einlegen. Seit Ausbruch des Siebenjährigen Krieges 1756 herrschte in Sachsen meist der Preußenkönig Friedrich II., jedenfalls nicht der nach Polen vertriebene und 1763 erst zurückgekehrte Brühl, aber auch in dem auf 18 Jahre zu reduzierenden ‚Vierteljahrhundert’ war er nicht der ‚unumschränkte Herrscher’.“
Etwa zur selben Zeit nahm sich die Vogtländer Historikerin Dagmar Vogel der Sache Brühl an und durchforstete mit unendlichem Fleiß über Jahre die Archive. Der erste Band ihrer Biographie – erschienen im Jahr 2003 – umfasst beinahe siebenhundert Seiten und beschreibt doch nur wenig mehr als die erste Hälfte von Brühls Leben. Schier unendlich ist die Zahl der Details, die sie gesammelt hat. Eindrücklich widerlegte sie diverse Informationen, die offenbar nie genau überprüft worden waren, so den Ort seiner Geburt – er kam nicht in Gangloffsömmern, sondern in Weißenfels zur Welt – oder die Behauptung, er habe allein durch die Organisation der Heeresschau und der Festlichkeiten rund um das Zeithainer Lustlager (1730) die allumfassende Aufmerksamkeit des Königs auf sich gelenkt: „Die Akten liefern kaum Anhaltspunkte für eine Mitwirkung Brühls an der Ausrichtung des Zeithainer Lagers. Am 14. Januar 1730 übermittelte er dem Kammer-Kollegium einen Befehl Augusts II., der das benötigte Holz für die Zeithainer Bauten sowie Fourage für die Pferde betraf.“ Nach Vogels Erkenntnissen muss man sich ernsthaft fragen, wie steil Heinrichs Karriere wirklich gewesen ist. Auch Fellmanns Untersuchungen zeigen, wie lang seine berufliche Entwicklung gedauert hat.
Bahnbrechend schließlich war eine internationale Tagung zu dem Thema, die dank eines relativ unspektakulären Aufrufs im Internet, eines informellen „call for papers“, im März 2014 in Dresden zustande kam. Eingeladen hatten die Wissenschaftlerinnen Ute Koch von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und Cristina Ruggero von der Bibliotheca Hertziana in Rom. Zwei Tage lang diskutierten Forscher aus den Niederlanden, Polen, Deutschland und Italien intensiv über die Ereignisse im augusteischen Zeitalter. In einem umfangreichen Band publizierten die beiden Frauen später sämtliche Beiträge und Erkenntnisse dieser Tagung. Das Ergebnis war beeindruckend. Die Vorträge hoben samt und sonders die kulturelle und politische Bedeutung Sachsens im 18. Jahrhundert hervor und beschrieben Brühl als Mäzen seines Landes und Förderer seiner Vorgesetzten inmitten eines penibel entwickelten Netzwerkes von Kunstkennern und -händlern, das sich über ganz Europa erstreckte.
In seiner Publikation Architektur und Kunst in der Ära des sächsischen Ministers Heinrich Graf von Brühl (1738–1763), erschienen 2014 im Jan Thorbecke Verlag Ostfildern, konnte der Danziger Kunsthistoriker Tomasz Torbus die neuen Erkenntnisse bekräftigen. Gemeinsam mit Markus Hörsch und weiteren Experten dokumentierte er anhand von zahlreichen hervorragend reproduzierten Abbildungen, historischer Stadtpläne und Architekturskizzen vorurteilsfrei das kulturelle Engagement Heinrichs und verwies auf unmittelbare Parallelen zwischen der polnischen und sächsischen Geschichte, die sich aus der Zeit seines Wirkens ergaben.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgte das sächsische Landesamt für Denkmalkunde in seiner im April 2020 veröffentlichten Publikation Heinrich Graf von Brühl (1700–1763). Bauherr und Mäzen. Im Vorwort schreibt Landeskonservator Alf Furkert, Brühl habe sich „während der sächsisch-polnischen Personalunion eine herausragende Stellung in der höfischen Hierarchie erarbeitet“. Allein die Wahl des Verbes zeigt, dass hier eine Neubewertung vorgenommen wurde. Sachsen (und Polen), möchte man meinen, hatte(n) sich nach all den Jahren endlich zur Wehr gesetzt. Durch eine Veränderung der Perspektive von Krieg auf Frieden, von Machtentfaltung auf Kulturförderung, von Systemkritik auf vorurteilslose Betrachtung der handelnden Personen hatte sich alles verändert. In seinem Tagungsbeitrag Wie die Schrift Friedrich den Großen zu einem Gewinner und Heinrich von Brühl zu einem Verlierer der Geschichte machte dokumentierte der Historiker Jürgen Luh anschaulich, dass der Preußenkönig eine regelrechte publizistische Kampagne gegen Brühl führte. „Über Heinrich von Brühl wollte Friedrich – um seine eigenen Wort zu zitieren – ‚Gift ausschütten’.“ Und Historiker Frank Metasch entkräftete in seinem Vortrag die Behauptung, Heinrich habe Sachsen in den Ruin gestürzt: „Der sächsische Premierminister hat im Bereich der Finanzen und Schulden keinesfalls die allgemeine Entwicklung verschlafen. Wie insbesondere die kontroversen Diskussionen auf dem Landtag von 1749 zeigen, wurden ernsthafte Auswege aus der finanziellen Misere gesucht.“ Sachsen habe ferner, so Metasch, mit seiner Entwicklung zum Absolutismus im 18. Jahrhundert keineswegs allein dagestanden: „Hervorzuheben sind insbesondere der Hof und das Militär, der innere Ausbau des Staates und der Verwaltung sowie die gestiegenen außenpolitischen und repräsentativen Anforderungen im Zuge des dynastischen Aufstiegs der Wettiner zu polnischen Königen. All dies führte zu einer kontinuierlichen Steigerung der Ausgaben, ohne dass die Einnahmen des Staates im gleichen Maße mithielten. Eine solche Entwicklung bildete jedoch kein sächsisches Alleinstellungsmerkmal.“
Damit war der Weg frei für breiter angelegte Forschungen. Insbesondere die Entwicklung von Sachsens Kultur und Kunstfertigkeit im europäischen Rahmen hatten die beiden Wissenschaftlerinnen in ihren Fokus genommen, denn die Leidenschaft für Kunst, die Entscheidung, die persönliche Macht des jeweiligen Herrschers in künstlerischer Prachtentfaltung zu manifestieren, die seit dem 16. Jahrhundert über Jahrzehnte am sächsischen Hof dominierte, zog eine konsequente Förderung von Künstlern und ihren individuellen Fertigkeiten nach sich. Ob Maler, Zeichner oder Bildhauer, Porzelliner oder Goldschmiede, Holzschnitzer oder Tischler, Vergolder, Diamantenschleifer oder Kupferstecher, nicht zu vergessen Komponisten, Schauspieler und Musikinterpreten – sie alle fanden hier Liebhaber und Abnehmer ihrer Werke, konnten sich entfalten und sukzessive weiterentwickeln. Der Hof und sein gesamtes Umfeld unterstützten sie darin.
Das alles zu finanzieren kostete seinen Preis, aber es maß diesen Fertigkeiten spezifische Bedeutung und Wertschätzung bei. Dadurch entstand Raum zu kreativer Gestaltung, der in der Folge seine ganz eigene Dynamik entwickelte. Die Künstler inspirierten sich gegenseitig und suchten nach immer neuen Techniken und Materialien, um ihre Ideen und Visionen zu verwirklichen. In der vollendeten Herstellung ihrer Werke und im Zusammenspiel unterschiedlicher Fähigkeiten entstanden innovative Gesamtkunstwerke von weitreichender Wirkung. Sie standen für das Kurfürstentum als Ganzes, strahlten über die Grenzen Sachsens hinaus und verliehen ihm Ansehen und Bedeutung.
Dank Heinrichs Persönlichkeit und Stellung waren er und seine Familie – seine Brüder, Kinder und Nachfahren – zwangsläufig an dieser Entwicklung in Sachsen beteiligt. Sie unterstützten sie aus vollem Herzen, einerseits aus Loyalität und Diensteifer, andererseits aus innerer Überzeugung. Ihre Ergebnisse, seien es einzelne Kunstwerke oder Anwesen oder auch die Kultur des Umgangs, Bildung und Erziehung, wurden gepflegt und respektiert, die Verantwortung dafür Teil der eigenen Geschichte, die das Handeln einzelner Familienmitglieder bis in die Neuzeit prägte.
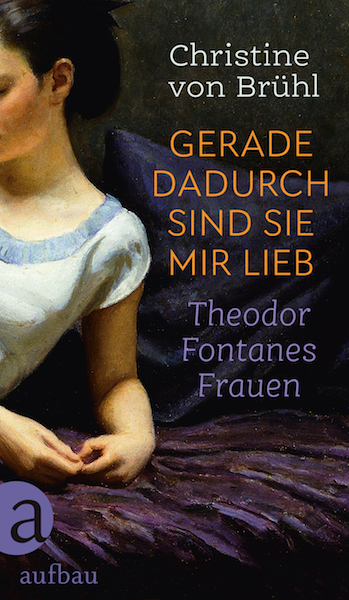
Gerade dadurch sind sie mir lieb. Theodor Fontanes Frauen
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2018.
Bestellen über den Aufbau Verlag
Obwohl wir längst in einer gänzlich anderen Zeit leben, verfolgen wir heute noch mit Spannung das Schicksal von Hilde Rochussen (Ellernklipp, 1881), hoffen inständig, dass der Junge, den sie liebt, nicht vom Vater erschlagen wird. Wir empören uns über Baron von Innstetten, der den Liebhaber seiner Frau ganze sechs Jahre nach dem Ende der Affäre kaltblütig im Duell erschießt (Effi Briest, 1895). Oder wir leiden mit Ernestine Rehbein, genannt Stine, von der wir erfahren, dass ihr Verehrer Waldemar Graf von Haldern ihr aufrichtig zugetan ist (Stine, 1890). Da er sie aus Standesgründen jedoch nicht heiraten kann, setzt er seinem Leben ein Ende. Seite an Seite mit Stine schleichen wir uns heimlich zu seiner Beerdigung und fragen uns gleichermaßen, warum diese Geschichte so tragisch hat ausgehen müssen.
Interessant ist, dass es gerade die Frauenfiguren sind, an denen Fontane exemplarisch die gesellschaftlichen Widersprüche aufzeigte, die er zu kritisieren suchte. In ihren Lebensentwürfen kulminieren die dramatischen Momente, die solche Widersprüche nach sich ziehen. Auch dem englischen Historiker Gordon A. Craig, der wie kein anderer die Präzision in Fontanes Schilderungen gepriesen hat, fiel auf: „Trägerinnen seiner Kritik in den Romanen und Erzählungen waren zumeist die Frauen, die nicht selten über den unmenschlichen und antiquierten Verhaltensnormen unglücklich wurden und an ihnen zerbrachen.“[i]
Wie zur Bestätigung schrieb Fontane in einem Brief an seine Freunde Paul (1854–1916) und Paula Schlenther (1860–1938): „Wenn es einen Menschen gibt, der für Frauen schwärmt und sie beinahe doppelt liebt, wenn er ihren Schwächen und Verirrungen, dem ganzen Zauber des Evatums, bis zum infernal Angeflogenen hin, begegnet, so bin ich es (…).“[ii]
Woher rührte diese Leidenschaft? Und woher bezog Fontane seine Informationen über das weibliche Geschlecht, beschritt er doch bei der Beschreibung von Frauen ein Terrain, das einem Mann des neunzehnten Jahrhunderts größtenteils verschlossen blieb. War er ein wilder Liebhaber, der sich schwärmerisch von einer Kemenate in die andere schwang, immer auf der Suche nach einem neuen Weiberherz, das es zu erobern galt? War er Charmeur und Schwerenöter zugleich? Im Gegenteil: Fontane war ein grundsolider Charakter. Abgesehen von zwei außerehelichen Schwangerschaften, die er mit Ende zwanzig verursacht haben muss, verliebte er sich als Jugendlicher in Emilie Rouanet-Kummer (1824–1902), verlobte sich mit ihr im Alter von sechsundzwanzig Jahren, heiratete sie fünf Jahre später und blieb ihr sein Leben lang treu.
Oder war Fontane ein Mitstreiter der Frauenbewegung, die zu seiner Zeit gerade erstarkte? Sah er sich als Fürsprecher der englischen Suffragetten, als Sprachrohr der bürgerlichen Kämpferinnen um Helene Lange (1848–1930) und Auguste Schmidt (1833–1902) oder gar als Vertreter der sozialistischen Bewegung um Clara Zetkin (1857–1933)? Wollte er mit seinen Erzählungen, Novellen und Romanen für Frauen das Recht auf Abitur, Studium und Erwerbsarbeit, dazu das Wahlrecht erwirken?
Oder war sein Interesse vielleicht ganz anderer Natur? Trieben ihn vielmehr diffuse Gelüste nach seinen Schwestern, seiner Tochter, wie eine Forschungsarbeit zu Fontane nahelegt?[iii]Lebte er in seinem Werk inzestuöse Phantasien aus?
All diesen Fragen geht das vorliegende Buch nach und versucht Klarheit darüber zu schaffen, was Fontanes Movens war, sich mit der Sache der Frauen zu befassen. Zweifelsohne gingen seine präzisen Kenntnisse unter anderem auf die Frauen zurück, die ihn direkt umgaben. Entscheidend war zum Beispiel sein Verhältnis zu Martha (1860–1917), seiner einzigen Tochter, die ihn freimütig an ihrem Leben als Mädchen, Jugendliche und schließlich erwachsene Frau teilnehmen ließ. Große Anhänglichkeit zeigte er auch gegenüber seiner Mutter Emilie, geborene Labry (1797–1869), sowie seinen Schwestern Jenny (1823–1904) und Elisabeth (1838–1923). Nicht zuletzt war seine Ehe eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Naturgemäß gab es Konflikte, doch Fontane zog Emilie stets ins Vertrauen und bewies ihr gegenüber eine geradezu anrührende Offenheit, wie der umfangreiche Briefwechsel der Eheleute zeigt
Einen weiteren Hinweis gibt Fontanes Art, auf Menschen zuzugehen. Dank seines freundlich-respektvollen und gleichzeitig humorvoll-unbedarften Charakters pflegte er eine Form von zwischenmenschlichem Umgang, mit dem er das Vertrauen seines Gegenübers leicht gewinnen konnte. Ähnlich wie viele Frauen hatte er eine Vorliebe für Plaudereien, erzählte gerne, dachte laut nach, hörte genau zu. Er spielte sich nicht auf und machte sich nicht künstlich wichtig. Entsprechend unbekümmert traten Frauen ihm gegenüber auf und teilten sich ihm offen mit.
Fontanes Schriftstellerkollegen machten sich darüber lustig. Sie nannten ihn „Nöhl“, ein berlinerischer Ausdruck, der für „nöhlen“ (quasseln, plaudern) steht. Aber gerade dadurch gelang es ihm wohl, eine spezifische Nähe zu seinem Gegenüber und engere Beziehungen zu Frauen herzustellen, die nicht seiner Verwandtschaft angehörten. Zu diesen gehörte beispielsweise die Diakonissin Emmy Danckwerts (1812–1865), die er als junger Mann in Pharmazie unterrichtete, oder Henriette von Merckel (1811–1889), die Witwe eines seiner Schriftstellerkollegen, und nicht zuletzt die Stiftsdame Mathilde von Rohr (1810–1889) in Dobbertin, bei der er sich längere Zeit aufhielt, mit der er Ausflüge machte und einen intensiven Briefwechsel führte. Auch in diesem Punkt bewies er sich als Zeitgenosse, der in Bereiche vordrang, die Vertretern seines Geschlechts gewöhnlich vorenthalten blieben. Überflüssig darauf hinzuweisen, dass er sein Leben naturgemäß in vorwiegend männlicher Gesellschaft verbrachte: in der Kindheit mit Schulfreunden und seinen Brüdern, später mit Kollegen von literarischen Gesellschaften wie „Tunnel“ oder „Rütli“, zu denen Frauen selbstverständlich keinen Zutritt hatten, oder mit Männerfreunden wie Bernhard von Lepel (1818–1885), Paul Heyse (1830–1914), Karl Zöllner (1821–1897) oder Georg Friedlaender (1843–1914), mit denen er zudem ausführlich korrespondierte.
Erstaunlich ist es, welche Bedeutung Fontane den Protagonistinnen in seinem Werk beimaß und wie präzise er insbesondere ihr Empfinden und Denken schilderte, diesen ausgesprochen komplexen und wechselhaften Bereich, den Frauen oft selbst nicht so genau zu durchschauen wissen. Woher nahm er dazu die Sicherheit, letztlich den Mut?
Auffallend ist auch, wie offen Fontane in seinen persönlichen Aufzeichnungen über die Befindlichkeiten und Krankheitsbilder von Frauen reflektierte, wie unbefangen sein Umgang damit war. So teilte er seiner Frau detailliert mit, wie sie die Kinder behandeln, welche Medikamente sie Tochter Martha verabreichen sollte. Auch ihr selbst gab er ärztliche Ratschläge, wenn sie sich unwohl fühlte.
Ausschlaggebend hierfür war seine Ausbildung zum Apotheker, durch die er nicht nur mit zeitgenössischen Heil- und Therapiemethoden, sondern auch mit den entsprechenden Essenzen vertraut war. Ihr verdankte er letztlich auch den unerschrockenen, analytischen Blick eines Naturwissenschaftlers und Mediziners, der es ihm ermöglichte, Frauen gesamtheitlich zu erfassen, ihr Verhalten einzuordnen und ihre Seelenzustände treffend zu beschreiben. Nicht zuletzt kannte er Krankheit und wiederkehrende Unpässlichkeit aus persönlicher Erfahrung.
Fontanes Schilderungen waren derart gegenwarts- und ortsbezogen, dass sich mancher Zeitgenosse kritisch darüber äußerte, wenn er einzelne Geschäfte, Personen und Plätze in seinen Werken unbekümmert beim Namen nannte. Dann erhielt er Zuschriften von übereifrigen Lesern, die einzelne Wegbeschreibungen oder Details als fehlerhaft empfanden.
Fontane reagierte mit Engelsgeduld: „Es ist mir selber fraglich, ob man von einem Balkon der Landgrafenstraße aus den Wilmersdorfer Turm oder die Charlottenburger Kuppel sehen kann oder nicht. Der Zirkus Renz, so sagte mir meine Frau, ist um die Sommerszeit immer geschlossen. (…) Gärtner würden sich vielleicht wundern, was ich alles im Dörrschen Garten à tempo blühen und reifen lasse; Fischzüchter, daß ich – vielleicht – Muränen und Maränen verwechselt habe; Militärs, daß ich ein Gardebataillon mit voller Musik vom Exerzierplatz kommen lasse; Jacobikirchenbeamte, daß ich den alten Jacobikirchhof für ‚tot‘ erkläre, während noch immer auf ihm begraben wird. Dies ist eine kleine Blumenlese, eine ganz kleine, denn ich bin überzeugt, daß auf jeder Seite etwas Irrtümliches zu finden ist. Und doch bin ich ehrlich bestrebt gewesen, das wirkliche Leben zu schildern. Es geht halt nit. Man muß schon zufrieden sein, wenn wenigstens der Totaleindruck der ist: ‚Ja, das ist Leben.’“[iv]
Gerade was Frauen angeht, dokumentierte Fontane die Umstände und gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen sie im neunzehnten Jahrhundert lebten, besondes präzise. Dadurch lieferte er, nicht zuletzt, wertvolle Informationen zu ihrer jeweiligen persönlichen Lebenssituation und leistete ganz allgemein einen wesentlichen Beitrag zur Kulturgeschichte der Frau.
Ein besonderes Interesse zeigte Fontane an Frauenschicksalen, die mit dem bürgerlichen Moralkodex seiner Zeit im Konflikt standen. Das spiegelt sich in seinem Werk und wurde von Zeitgenossen streng verurteilt. So soll ein Mitinhaber der Vossischen Zeitungin der Zeit, in der Irrungen, Wirrungen (1888)vorabgedruckt wurde, den Chefredakteur in höchster Erregung gefragt haben: „Wird denn die gräßliche Hurengeschichte nicht bald aufhören?“[v]In einem Brief an seinen Sohn Theodor machte Fontane seinem Ärger darüber Luft: „Wir stecken ja bis über die Ohren in allerhand konventioneller Lüge und sollen uns schämen über die Heuchelei, die wir treiben, über das falsche Spiel, das wir spielen. Gibt es denn, außer ein paar Nachmittagspredigern, in deren Seelen ich auch nicht hineinkucken mag, gibt es denn außer ein paar solchen fragwürdigen Ausnahmen noch irgendeinen gebildeten und herzensanständigen Menschen, der sich über eine Schneidermamsell mit einem freien Liebesverhältniswirklichmoralisch entrüstet? Ichkenne keinen und setze hinzu, Gott sei Dank, daß ich keinen kenne. (…) Empörend ist die Haltung einiger Zeitungen, deren illegitimer Kinderbestand weit über ein Dutzend hinausgeht (der Chefredakteur immer mit dem Löwenanteil) und die sich nun darin gefallen, mir ‚gute Sitte‘ beizubringen. Arme Schächer!“[vi]
Aus heutiger Sicht klingt die Einschätzung von Fontanes Leistung natürlich ganz anders. So stellte Craig fest: „Für seine Zeit nahm Fontane eine einzigartig aufgeschlossene Haltung gegenüber Frauen ein, denn er mochte sie und gestand ihnen Eigenschaften zu wie Intelligenz, Mut und geistige Unabhängigkeit, die andere Männer nicht wahrnahmen.“[vii]
Die folgenden Kapitel nehmen sich der Frauen an, denen Fontane zu seinen Lebzeiten besonders nahestand, und arbeiten das Außergewöhnliche der jeweiligen Beziehung heraus. Im Anschluss daran werden die literarischen Frauenfiguren in seinem Werk beleuchtet, besonders jene, die auf ein historisches Vorbild zurückgehen. Selbstredend hat Fontane seine Protagonistinnen frei erfunden, doch er ließ sich in einzelnen Fällen von lebenden Personen inspirieren.
Bei vielen Charakterisierungen stand ihm seine Tochter Martha Pate. Sie diente als Vorbild für die Figur der Corinna und inspirierte ihn mit ihrer natürlichen Selbstverständlichkeit und Redegewandtheit auch bei der Darstellung von Grete Minde, Lene Nimptsch, Brigitte Hansen, Ebba von Rosenberg, Effi Briest oder auch Melusine Ghiberti. Sie ist dadurch unwillkürlich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit geraten.
Zunächst widmen wir uns jedoch der Frauenbewegung und zeigen Parallelen zu Fontanes Biographie auf.
[i]Craig 1997, S. 3.
[ii]Brief vom 6. Dezember 1894, Erler 1980, Bd. 2, S. 352.
[iii]Vgl. Dieterle 1996.
[iv]Brief vom 15. Februar 1888 an Emil Schiff in: Theodor Fontane, Irrungen, Wirrungen, München 1974, S. 190.
[v]Vergl. Goldammer u. a. 1984, Bd. 5, S. 544.
[vi]Ebenda, S. 545.
[vii]Craig 1997, S. 246.
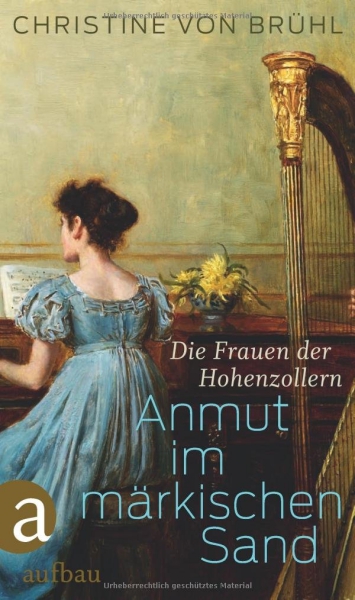
Anmut im märkischen Sand. Die Frauen der Hohenzollern
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2015.
Bestellen über den Aufbau Verlag
Friedrich I. (1371-1440) engagierte sich treu in der unspektakulären Region am äußersten Rand des Heiligen Römischen Reiches, seine Nachfahren taten es ihm gleich und bauten peu à peu die Vormachtstellung des lange Zeit ärmsten und rückständigsten Kurfürstentum aus. Mehr als fünfhundert Jahre in Folge hielt sich die Familie in der Mark. Unter ihrer Ägide wurde aus dem kargen, wenig ertragreichen Landstrich ein prosperierendes Königreich. Was an Preußen heute fasziniert, ist vor allem das kulturelle Erbe, das seine Regenten hinterlassen haben. Seien es herrliche Schloss- und Parkanlagen wie Charlottenburg oder Sanssouci, die Schinkelbauten, die bis heute die Straßen im Herzen Berlins säumen, Theater Museen oder Universitäten. Seien es bedeutende Komponisten wie Johann Sebastian Bach oder Carl Maria von Weber, die sich hier inspirieren ließen, oder Texte von Kleist oder E.T.A. Hoffmann, die hier entstanden. All dies strahlt bis in unsere Gegenwart hinein. Christine von Brühl zeigt erstmals auf, wie groß hierbei der Einfluss der Frauen der Familie Hohenzollern war.
Mit Preußen wird gemeinhin soldatische Strenge und Disziplin assoziiert. Unvergessen bleibt das Urteil, mit dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. (1688–1740) seinen Ältesten, Friedrich (1712–1786), bestrafte, weil der Junge mit seinem Freund Hans Hermann Katte (1704–1730) versucht hatte, dem Militärdienst zu entfliehen. Friedrich musste dabei zusehen, wie der Leutnant zum Tod verurteilt und enthauptet wurde.
Ungerecht waren auch die Anschuldigungen, mit denen derselbe Friedrich später, als er König geworden war, seinen Bruder August Wilhelm von Preußen (1722–1758) im Siebenjährigen Krieg mit seinen Generälen konfrontierte. Der König behauptete, der Bruder habe den Abzug
seiner Soldaten verzögert und sie absichtlich ins Verderben geführt, dabei war es Friedrich selbst gewesen, der den Aufenthalt befohlen hatte. Sie hätten alle miteinander verdient, ließ Friedrich seinen Stab wissen, die Köpfe zu verlieren. Die öffentliche Abfuhr löste bei August Wilhelm ein seelisches Debakel aus, von dem er sich nie wieder erholte. Noch vor Ende des Krieges verstarb er.
Wer jedoch heute das Land besucht, in dem die Hohenzollern einst herrschten, interessiert sich weder für Disziplin noch für soldatische Strenge. Er besichtigt Potsdam mit seinen Schlössern und Parks, besucht die Museumsinsel in Berlin mit ihren Sammlungen von Weltrang, spaziert die Prachtstraße Unter den Linden entlang und bewundert die klassizistischen Bauten. Eine Vielzahl dieser Schönheiten des Landes verdanken wir allerdings nicht seinen Herrschern, sondern deren Ehefrauen. Während sich die Kurfürsten, Könige und Kaiser um Politik und Machterhalt kümmerten, bemühten sich ihre Ehegattinnen um den Bau von Schlössern, Gärten und Kirchen, die Förderung von Künstlern und Literaten oder stifteten soziale Einrichtungen. Wenn die Bürger eine neue Kirche brauchten, wandten
sie sich nicht an den König, sondern an die Königin.
So ist es der Initiative von Louise Henriette von Oranien, der Frau des Großen Kurfürsten (1620–1688), zu verdanken, dass eine Fülle bedeutender Architekten und Landschaftsgestalter, Künstler und Gelehrter, ja nicht zuletzt von Ingenieuren und Fachleuten im 17. Jahrhundert ihren Weg aus den wirtschaftlich blühenden Niederlanden nach Brandenburg fand. Sie bauten das nach dem Dreißigjährigen Krieg zerstörte und entvölkerte Land wieder auf, halfen beim Einrichten von Wohnbauten und Entwässerungsanlagen und brachten Gewerke und Fertigkeiten in die Region, die hierzulande noch keiner kannte. Auch Sophie Charlotte von Hannover, zweite Ehefrau Friedrichs I. (1657–1713), konnte einbringen, was sie ihren neuen Untertanen an Bildung und Weltoffenheit voraus hatte. Sie ließ sich in Lietzenburg ein Lustschlösschen bauen und gründete dort einen Musenhof von europäischem Rang. Nach ihrem Tod wurde das Anwesen nach ihr Charlottenburg genannt. Luise von Mecklenburg-Strelitz subventionierte Heinrich von Kleists literarisches Schaffen mit Geldern aus ihrer Privatschatulle. Victoria von Großbritannien ließ das Neue Palais in Potsdam renovieren und englische Bäder einrichten und Auguste Victoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, die sogenannte »Kirchenjuste«, sorgte für den Bau und die Einweihung unzähliger neuer Kirchen.
Dieses Engagement war keine Selbstverständlichkeit, denn ursprünglich stammte keine dieser Frauen aus Preußen. Meist waren sie bei ihrer Heirat noch sehr jung, Sophie Charlotte war beispielsweise erst fünfzehn, und selbstverständlich galten solch eine Heirat und die damit
verbundene Trennung von der Familie für die Ewigkeit, denn Scheidung war eigentlich keine Option. Hinzu kam, dass das neue Zuhause meist weit weg und mangels guter Straßen und moderner Fortbewegungsmittel schwer erreichbar war. Je weiter die einstige Heimat von der neuen Residenzstätte entfernt war, desto unwahrscheinlicher war es, dass die junge Braut ihre Familie jemals wiedersehen würde.
Fortan hatte der Ehemann für sie zu sorgen, und sie hatte dem Angetrauten und seinen Verwandten treu ergeben zu sein, denn sie gehörte von einem Tag auf den anderen zu einer neuen Familie. Sie musste die vielen Gesichter kennen lernen, die durch ihre Heirat neu in ihr Leben gekommen waren, die Zusammenhänge und Verwandtschaftsgrade zwischen den unterschiedlichen Menschen erfassen, die dazu gehörten, und sich bald auch in der Geschichte und den Traditionen der Schwiegerfamilie auskennen. Sie musste lernen, ihre Sprache zu sprechen und sich den Ritualen unterzuordnen, die hier herrschten. Manch eine wechselte dafür sogar ihre Konfession.
Das war insbesondere von Bedeutung, da jede von ihnen gerade den Ältesten der Familie geheiratet hatte. Er übernahm traditionsgemäß die Hauptverantwortung für den Fortbestand der Familie, verwaltete das Erbe und war überdies der Thronfolger. Früher oder später würden diese Frauen an der Seite ihres Mannes über die Geschicke eines ganzen Landes mitbestimmen.
Ihre vorrangigste Aufgabe war, möglichst bald möglichst viele Kinder zu gebären, insbesondere Jungen. Viele Herrscherinnen, von denen in diesem Buch die Rede sein
wird, brachten Jahr um Jahr ein Neugeborenes zur Welt. Das war eine Selbstverständlichkeit. Wer als Frau diese Aufgabe, deren glücklichen Ausgang schließlich niemand in der Hand hat, nicht erfüllen konnte, hatte ein unlösbares Problem.
Bei jeder Geburt ging es um Leben und Tod – sowohl für den Säugling als auch für die Mutter. Doch bei der hohen Rate an Säuglings- und Kindersterblichkeit durfte es keinesfalls nur einen möglichen Thronfolger geben. Bei der Heirat Luises von Mecklenburg-Strelitz wurde beispielsweise vertraglich vereinbart, dass sie eine festgelegte Summe zur Disposition erhalten solle, die sich bei der Geburt eines Sohnes erheblich erhöhen würde. Bei der Geburt einer Tochter war derlei nicht vorgesehen.
Aus der Perspektive einer Monarchie waren Frauen, die keine Kinder gebaren, eine Existenzbedrohung. Es ging um den unbedingten Erhalt der Familie, gleichzeitig um die wachsende Zahl ihrer Mitglieder. Nur dann waren die jeweiligen Erstgeborenen in der Lage, den Hegemonialanspruch ihres Hauses dauerhaft aufrecht zu erhalten. Erbe wurde immer nur der älteste Sohn, der aus der Verbindung mit der standesgemäß ersten, rechtmäßigen Ehefrau entstanden war. Lieblingsneffen galten nicht, Kinder, die in außerehelichen Verbindungen entstanden waren, gleich gar nicht, Adoptionen waren ausgeschlossen. Starb der Älteste, rückte der im Alter nächste Bruder nach. Die Verantwortung wurde nie geteilt. Diese Regelung war, insbesondere in Preußen, oberstes Gesetz.
Darüber hinaus hatte die Eheschließung mit einem Thronfolger ihre eigene Brisanz. Heirat war immer auch mit Politik verbunden, mit Macht und der Erschließung dauerhafter Netzwerke. Von Gefühlen konnte hier kaum die Rede sein. Es war die Möglichkeit, zwei Herrschaften im Frieden miteinander zu vereinen und den Besitz eines der beiden Häuser zu mehren. Während es in dieser Zeit primär um den Erhalt einer Herrschaft ging, war es in
zweiter Linie wichtig, sie geographisch zu erweitern und ihre Einflussnahme zu vergrößern.
Hatten die Frauen alle Anfangsschwierigkeiten überwunden, hatten sie sich im Haus und vor ihren Angestellten Respekt und Ansehen erworben und einen ersten potentiellen Thronfolger geboren, hatten sie eine Persönlichkeit entwickelt, die ihnen kraftvolles Auftreten und e in selbstbestimmtes Wesen erlaubte, konnten sie sich schließlich vielleicht auch noch dem Bau von Schlössern und Kirchen widmen. Dabei halfen ihnen die finanziellen Mittel, die sie mit in die Ehe gebracht hatten. Um ihnen den Neubeginn zu erleichtern, waren sie – im besten Fall –
mit kostbaren Gütern und hohen Geldbeträgen ausgestattet worden: der sogenannten Mitgift. Sie war innerhalb der Familie gesammelt und angeschafft worden, während die Braut heranwuchs. Vorzugsweise handelt es sich um Gegenstände von besonders guter Qualität und hohem Wert, denn sie sollten möglichst lang, wenn nicht gar ewig halten. Es waren, was das Wort Mit-Gift auch etymologisch bedeutet, Geschenke, kostenlose Gaben, die keinesfalls zurückgefordert werden konnten.
Die Eheschließung fand auf der Basis eines Vertrags statt. Die Lebensumstände der jungen Frau wurden genau festgelegt. Es sollte ihr auch in Zukunft an nichts mangeln. Je vornehmer und wohlhabender das Haus war, aus dem sie stammte, je umfassender die Mitgift und reicher die Geschenke, desto präziser waren die Verträge. Alle Einzelheiten wurden vorab geregelt und festgeschrieben, Ausstattung, Anzahl des Personals, Schmuck und andere Gegenstände,
die auch nach der Heirat im Besitz der Frau zu verbleiben hatten – jedes Detail wurde vereinbart und gesichert. Insbesondere der Witwensitz und seine angemessene
Qualität wurden vorab festgehalten.
Die Mitgift war viel wert, manche Frauen brachten ganze Ländereien und Güter mit in die Ehe. Es waren Geschenke für ihre neuen Familien. Sie wurden der Herrschaft des Ehemannes zugeschlagen und gingen der ursprünglichen Kernfamilie verloren. Es waren nun keine Oranier, keine Welfen mehr, die in diesen Gebieten regierten, sondern Brandenburger. Die dortigen Bewohner hatten sich damit abzufinden. Preußen verdankt sogar seine Ursprünge, das Land, von dem es seinen Namen bekam, dem Mitbringsel einer Ehefrau. Anna von Preußen (1576–1625) brachte das Herzogtum mit in die Ehe, auf dessen Basis später das Königreich Preußen entstand. 1594 heiratete sie Johann Sigismund von Hohenzollern (1572–1619), Kurfürst von Brandenburg, und da ihre Brüder das Erwachsenenalter nicht erreichten, erbte sie 1618, als ihr Vater verstorben war, das Land ihrer Herkunft. Obwohl es dorthin keine geographische Verbindung gab, nannten sich die Hohenzollern fortan Kurfürsten von Brandenburg und Herzöge von Preußen.
Die Herrschaft war erblich. Zahlreiche Erstgeborene der Familie kamen in Königsberg, der Residenzstadt Preußens, auf die Welt. 1701 ließ sich Friedrich I. dort als erstes Mitglied der Dynastie zum König in Preußen krönen. Sämtliche Thronfolger der Familie Hohenzollern folgten diesem Beispiel und reisten zu ihrer Krönung nach Königsberg.
Anna war eine eigenwillige Frau. Sie galt nicht als sonderlich attraktiv, hatte einen starken Willen und war äußerst temperamentvoll. Wenn sich ihr Mann, der Kurfürst, ausschweifenden Trinkgelagen hingab, bewarf sie ihn gelegentlich vor Wut mit Tellern und Krügen. Sie war zudem schlau und ihrem Mann intellektuell überlegen. Nicht nur das Herzogtum Preußen brachte sie mit in ihre Ehe, sondern auch Ansprüche auf die vereinigten Herzogtümer Jülich, Kleve, Berg, die Grafschaften Mark und Ravensberg sowie die Herrschaft Ravenstein im Westen des Landes. Bei den Verhandlungen um die Erbfolge saß sie mit am Tisch, setzte sich erfolgreich gegen ihre Konkurrenten durch und musste ihre Rechte am Ende lediglich mit den Fürsten von Pfalz-Neuburg teilen. Im Vertrag von Xanten wurden Brandenburg 1614 zusätzlich zu Preußen die Herrschaften Kleve, Mark und Ravensberg zugesprochen.
Selbstredend kam die eigenwillige Anna auch ihren Fähigkeiten als Lebensstifterin nach. Sie gebar acht Kinder, von denen die drei Jüngsten allerdings kurz nach der Geburt wieder verstarben.
Doch zurück zum Thema Mitgift: Was für Gedanken müssen die Eltern bewogen haben, wenn ihre Töchter derart ausgestattet von dannen zogen? Wie müssen sie sich gefühlt haben, da sie wussten, dass die Güter, die sie ihnen mitgaben, der eigenen Familie für immer verloren gingen, nicht zuletzt ihr wohlerzogenes, im besten Fall hervorragend ausgebildetes Kind? Und was muss die Tochter empfunden haben, wenn sie ihre Familie zum letzten Mal
sah? Nach außen hin zeigten sie sicherlich Stolz und Freude, doch auch von der Einsamkeit und dem Heimweh, mit denen sich die jungen Bräute zu Beginn ihrer Ehe plagten, zeugen unzählige Korrespondenzen. Nicht allen gelang es, sich vor Ort durchzusetzen. Allein gut ausgebildete Frauen mit einem starken Charakter kamen mit der Herausforderung zurecht und entwickelten sich zu selbstbestimmten, kraftvollen Herrschersgattinnen.
Daher wird im Folgenden keineswegs nur von materiellen Gütern die Rede sein. Eindeutig ist, dass auch oder gerade der Teil der Mitgift den Töchtern zu Rang und Ansehen verhalf, der eher im ideellen, persönlichkeitsstiftenden Bereich anzusiedeln ist: Bildung, Charakterstärke,
Herzensgüte. Gerade daran hat es Preußens Herrschern aufgrund der rigiden Vorstellungen von Erziehung und Strenge in diesem Land immer gemangelt. Die ideellen Mitbringsel der Frauen, die Liebe zur Musik und zur Literatur, die Überzeugung, dass Hilfsbereitschaft unabdingbar ist und Bildung ein Zeichen von Niveau, waren letztlich die Eigenschaften, die dem Land zu Ansehen und kultureller Blüte verhalfen.
Dazu zählt, auch wenn es zweitrangig erscheint, die Art der Erziehung der Kinder, das Zeremoniell und die Umgangsformen, auf die einzelne Herrscherinnen in ihrer Entourage
Wert legten (oder eben nicht!), ihr Stil und ihre Vorlieben, die Einrichtung der Räumlichkeiten und Salons, die Wahl ihrer Gäste, der intellektuelle Austausch mit Denkern aus anderen Regionen und Ländern. Allein durch den intensiven, persönlichen Kontakt Sophie Charlottes zu dem Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) kam dieser auf die Idee, 1700 in Berlin nach englischem und französischem Vorbild eine Akademie der Wissenschaften zu gründen. Nachdem Luise auf Anhieb Karl Friedrich Schinkel (1781–1841) ins Herz geschlossen hatte und diese Freundschaft sich dem König als Erinnerung an seine geliebte Frau einprägte, erhielt der Künstler selbst über ihren Tod hinaus zahlreiche Aufträge und fand Gelegenheit, seine künstlerischen Ambitionen in Preußen zu verwirklichen. Bis heute prägen seine Bauten das historische Zentrum Berlins.
Das Gute an dem fremden Blick, den die Frauen nach Preußen mitbrachten, war, dass sie vor Ort Tendenzen und Strömungen aufspüren sowie Besonderheiten entdecken konnten, die den Alteingesessenen nicht auffielen. Sie konnten Stile und Neuheiten einführen, die sie aus ihrer Heimat kannten, Wissen nutzen, das dort längst bekannt war. Sie waren diejenigen, die Kleider- und Frisurmoden kreierten, phantasievolle Feste initiierten und stimmungsvolle Konzerte veranstalteten. Sie zeichneten Theateraufführungen und Ausstellungen durch ihren Besuch aus, stifteten Preise und wirkten im gesamten Land und weit über dessen Grenzen hinaus stilbildend und kulturfördernd.
Wenn die Herrscherin starb, weinte das ganze Land. Manch kostbares Grabmal wurde gestiftet, kunstvolle Sargmonumente wurden für sie gefertigt, die wiederum die kulturelle Blüte des Landes spiegelten. Einzelne Königinnen hinterließen Stiftungen und Gelder, die über ihren Tod hinaus soziale Einrichtungen förderten oder Kunst und Künstler unterstützten.
Von all diesen guten und großen Taten soll in diesem Buch ebenso die Rede sein wie von Missgriffen und Ungeschicklichkeiten. Sämtliche 16 Herrscherinnen wurden in Augenschein genommen, die in den letzten dreihundert Jahren bis Ende der Monarchie in das Haus Hohenzollern einheirateten. Angefangen mit Louise Henriette von Oranien bis in die Neuzeit zu Hermine Reuß ältere Linie, der zweiten Frau Wilhelms II. (1859–1941), wird jede der
Frauen einzeln vorgestellt und beschrieben, was sie neben ihrer Tätigkeit als Mutter und Repräsentantin des Landes kulturell zu dessen Fortbestand beigetragen hat. Um ihr Wirken zu versinnbildlichen, wurde jeder Einzelnen die Abbildung eines kunsthistorisch bedeutenden Baus zur Seite gestellt, der unmittelbar mit ihrem Dasein zu tun hat. Geachtet wurde darauf, dass es sich dabei möglichst um Anlagen handelt, die heute noch existieren. Daran lässt sich zeigen, wie lange die Wirkung der Frauen andauerte und Bestand hatte. Einige der genannten Schlösser trugen gerade nach der Wende wieder neu zur Bildung eines kulturellen Selbstverständnisses bei. In Zeiten von Umbrüchen und starken Veränderungen stifteten sie dauerhaft Identität.
Interessant ist, wie unterschiedlich ausgeprägt das Vergnügen einzelner Herrscherinnen an der persönlichen Einflussnahme war und wie stark das jeweilige persönliche Engagement divergierte, unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht auf ihre Aufgabe vorbereitet worden war. Eine Ehefrau wie Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach beispielsweise, die mit Wilhelm I. (1797–1888) verheiratet und für die Position einer Regentin exzellent ausgebildet worden war, bewies bei der Erfüllung ihrer Aufgaben kein sonderliches Geschick. Auguste Harrach hingegen, zweite Frau Friedrich Wilhelms III. (1770–1840), traf der Heiratsantrag des Königs vollkommen überraschend. Gänzlich unvorbereitet gelangte sie in die Position einer königlichen Ehefrau. Gerade sie aber führte als Herrscherin eine Kultur des Umgangs miteinander ein, die in seiner Bescheidenheit und Zurückhaltung beispielgebend war. Am ungewöhnlichsten war dahingehend zweifelsohne Luise, doch auch eine Frau wie Friederike Luise überraschte alle Welt nach dem Tod ihres Mannes mit ihrem plötzlich erwachenden Gestaltungseifer. Erst als Friedrich Wilhelm II.(1786–1797) nicht mehr lebte, war sie mental dazu in der Lage.
Louise Henriette von Oranien macht in dem Reigen den Anfang, denn sie sticht in allem hervor. Kaum eine eingeheiratete Herrschergattin hat derart selbstverständlich und bescheiden ihr Wissen, ihr Vermögen und ihre persönliche Charakterstärke genutzt, um dem Land ihres Mannes Gutes zu bringen. Keine andere wusste den Raum, der ihr dank ihrer neuen Position zur Verfügung stand, sinnvoller zu nutzen. Dem Gestaltungswillen solcher Frauen wie ihr ist es zu verdanken, dass die Region, die einst Preußen hieß, bis heute eine fruchtbare und reiche Kulturlandschaft geblieben ist.
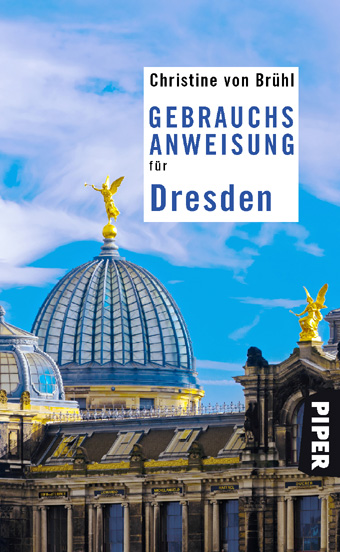
Gebrauchsanweisung für Dresden
© Piper Verlag GmbH, München 2012.
Bestellen über den Piper Verlag
Wenn er warm und duftend aus dem Ofen kommt, schneidet ihn die Bäckerin in rechteckige Stücke. Jedes Stück ist gleich groß, jedes hat die Form eines Quaders, jedes sieht aus wie ein Baustein. Und so wird es auch behandelt. In Sachsen wird Kuchen gestapelt. Schon beim Verkauf werden die Kuchenteile eng auf einen kleinen Pappteller gelegt, dann aufeinander getürmt, fest in Butterpapier eingeschlagen und zum Schluss auf der flachen Hand über die Theke gereicht. Wie ein Paket sieht das aus, wie ein großer verpackter Ziegelstein. In Sachsen verkauft man Kuchen in Paketen. Das ist praktisch, da kann nichts schief gehen.
Und später, wenn man mit den Freunden zusammensitzt und Kuchen isst, kann man gut teilen. Denn wer mag sich schon auf eine Kuchensorte beschränken. Normalerweise will man doch von jedem ein bisschen probieren. Und ein ganzes Kuchenstück ist eigentlich immer zu viel. Das ist hier kein Problem. Ein Rechteck lässt sich gut in zwei Quadrate schneiden, aus eins macht zwei. Und dann kann man wieder stapeln, rundstapeln, kunstvoll stapeln, ausprobieren, wie viele Stücke auf einen kleinen Frühstücksteller passen. Dazu gehört schon ein wenig Geschicklichkeit, ja technische Begabung, Fragen der Statik sollten hier unbedingt berücksichtigt werden. Aber nur Mut! Mit Stapeln beschäftigen sich schon Einjährige.
Bei gewöhnlichen Tortenstücken geht das nicht, bei diesen Schnitten, diesen kompliziert mehrschichtigen Dreiecken mit dem dämlichen Trennpapier, das die Verkäuferin scheinbar vorsorglich dazwischen legt, damit sich die unterschiedlichen Torten nicht gegenseitig bekleckern oder gar wollüstig ineinander sinken. Diese lächerlichen Papierchen, die ja doch nicht halten, wenn das einzelne Tortenstück von der Pappunterlage auf einen Teller geschoben wird. Spätestens dann fällt alles um, die einzelnen Schichten brechen auseinander, die hübsche Verzierung, der zarte Marzipanmantel, das gläserne Gelee, der extra dünne Boden, alles stürzt übereinander und macht aus dem Schichtwerk ein wüstes Schlachtfeld.
Das kann einem mit sächsischem Kuchen nicht passieren. Den kann man auf der Baustelle essen. Natürlich gibt es auch hierzulande Torten und entsprechende Unfälle bei Transport und Verzehr, doch das ist die Ausnahme. Der normale Kuchen ist ein Rechteck, und er wird gestapelt.
Und er schmeckt phantastisch. Welche Sorte man auch wählt, er schmeckt immer gut. Nicht zu trocken, nicht zu matschig, nicht zu fad und nicht zu süß. Bekannt ist hierzulande die sogenannte Eierschecke, ein Zusammenstellung aus Mürbteig, Quarkfüllung und einer Schicht Pudding mit geschäumten Eiern, aus der mache ich mir persönlich gar nichts. Für die unterschiedlichen Obststreuselsorten hingegen würde ich Kilometer laufen. Kirschstreusel, Apfelstreusel, Pflaumenstreusel. Das ist überhaupt der Allerbeste. Duftender, wespenumsummter, saftiger Pflaumenstreusel. Eine kleine Bäckersfrau mit drallen Oberarmen, der weiße Kittel platzt aus allen Nähten, die ungerührt von den ewig summenden, brummenden, auf- und abwebenden Biestern einen Block über den anderen packt. Das ist sächsischer Kuchen. Eine Wucht. Eine Katastrophe für die Taille. Einfach fantastisch.
Wenn die Kinder mittags aus der Schule kommen, gehen sie zum Bäcker und fragen nach Kuchenrändern. Meist gibt ihnen der Bäcker reichlich, eine ganze Papiertüte voll für höchstens eine Euro. Das hat Tradition. Denn bevor der Kuchen in Quader zerschnitten wird, trennt der Bäcker großzügig die Ränder ab. Und mit den Rändern kann er nichts anfangen, manche verschenken sie sogar. Dabei sind sie süß, knusprig und sie schmecken fast genauso gut wie der ganze Kuchen. Schon das ist sächsische Gastlichkeit, ja, Großzügigkeit. Oder fröhliche Gutmütigkeit.
Wer Dresden in der Advents- oder Weihnachtszeit besucht, wird beim Bäcker nicht nur Kuchen, sondern auch Dresdner Stollen finden. Er ist der bekannteste sächsische Kuchen, wenn man ihn überhaupt als solchen bezeichnen darf. Und er ist so reichhaltig, dass der Stollengenießer schon nach einem Stück Gefahr läuft zu platzen.
Ursprünglich war der Stollen eine adventliche Fastenspeise, seine Form soll an das in Leinen gewickelte Christuskind erinnern. Er bestand nur aus Mehl, Hefe, Öl und Wasser. 1491 genehmigte der Papst den Bäckern gegen gewisse Auflagen, finanzieller Art natürlich, dass sie Butter hinzufügen durften. Ab dann wurde der Stollen zunehmend verfeinert und schmeckte immer besser. Zum Beweis, doch vor allem zur Bestechung, brachten die sächsischen Bäcker noch bis ins 19. Jahrhundert dem König feierlich jeden zweiten Weihnachtstag zwei Stollen von ein Meter fünfzig Länge und 36 Pfund Gewicht. Buße für ein Stückchen Butter. Vom Butterzins, erzählt man, wurde der Freiberger Dom gebaut.
Viele backen den Stollen zuhause und selbst. Lange vor Adventsbeginn erfüllt der Duft nach süßem Teig, Rosinen, Mandeln, Zitronat und Orangeat Küche, Wohnung und Haus. Der Teig ist schwer und klebrig, es macht keinen Spaß ihn herzustellen. Außerdem darf man nachher nichts davon essen. Stollen muss ruhen. Er braucht Zeit. Tage und Wochen muss er im Kasten liegen, bis er sich bequemt, so zu schmecken, wie es sich gehört. Aber so ist das eben im Advent. Die meiste Zeit verbringt man mit Warten.
Wer Stollen selber backt, ist durchaus mutig, denn das ist eine ernste Angelegenheit. Das kann nicht jeder! Schon gar nicht jeder Bäcker. Behaupten vor allem die Bäcker, die sogenannten Stollenbäcker. Jedes Jahr sind die Zeitungen voll von neuen Geschichten über den Bäckerstreit. Die Stollenbäcker behaupten immer, andere Stollenbäcker würden zu viel Stollen backen und dafür viel zu wenig Geld nehmen. Das würde allgemein die Preise drücken, und außerdem sei billiger Stollen schlechter Stollen und gar kein richtiger Stollen. Anfang der Neunziger wurde eine Art Stollenbäckerclub gegründet, der Schutzverband Dresdner Stollen. Jedes Mitglied verpflichtet sich, achthundert Euro jährlich zu zahlen und nur ganz richtige Stollen zu backen. Dafür darf er sich dann im Herbst Qualitätssiegel kaufen, die auf seine Stollen kleben, sie aber nicht zu günstig verkaufen, denn sonst sind die anderen Clubmitglieder trotzdem sauer.
Wirklich und wahrlich echt ist wahrscheinlich nur der Christstollen, mit dem Jahr für Jahr der Dresdner Striezelmarkt, der älteste deutsche Weihnachtsmarkt, eröffnet wird. Denn hier schauen so viele Menschen zu, hunderttausende kamen im letzten Jahr, dass einfach gar nichts schief gehen darf.
Außerdem ist ein eigens gewähltes Stollenmädchen dabei und passt genau auf. Dieser Striezel, um das sächsische Wort für Stollen zu bemühen, misst vier bis fünf Meter, enthält tonnenweise Mehl, Millionen Sultaninen, mehrere hundert Kilogramm Zucker und viele Liter Rum. Die genauen Mengenangaben werden regelmäßig in der Lokalpresse veröffentlicht.
Die Zutatenmengen, mit denen hier hantiert wird, erinnern an das Zeithainer Lager von August dem Starken, anlässlich dessen 1730 ein Stollen gebacken wurde, der so groß und schwer war, dass er auf einem Pferdewagen zu den Festgästen gefahren wurde. Sechzig Gehilfen gingen dem Bäcker zur Hand, als der achtzehn Ellen lange und 1,8 Tonnen schwere Kuchen aus dem eigens dafür gebauten Ofen gezogen wurde. Impresario dieses Manövers und Repräsentationsspektakels war übrigens schon Heinrich Graf Brühl, der sich dabei seine ersten Sporen verdiente.
Was für ein Aufwand! Da lobe ich mir den Dresdner, der jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit still und unverdrossen zur Feinbäckerei Metasch in der Görlitzer Straße marschiert, dem wohl kleinsten Laden dieser Art in der Äußeren Neustadt, dort eine sorgfältig ausgeführte Liste von Adressen auf den Tresen legt, eine gewisse Summe Geld entrichtet und mit freundlichem Gruß wieder von dannen zieht.
Denn auch das ist Dresdner Sitte, und es ist eine schöne Sitte. Wer nicht selbst Stollen backen kann, lässt backen, und er lässt vor allem verschicken. Es gibt kaum eine Bäckerei, die diesen Service nicht anbietet. Und tatsächlich bringt mitten im Advent, wenn die Verzweiflung über trockene Lebkuchen und angebrannte Plätzchen in Frankfurt (selbstredend am Main), München oder im Sauerland schier grenzenlos ist, wenn in London die Angst vor dem traditionellen Plumpudding-Gelage schon die Kehle zuschnürt, in South-Carolina zu viel Sonne für die Jahreszeit scheint oder selbst im wunderbaren Südfrankreich ein wenig Sehnsucht nach der trauten deutschen Weihnacht ausgebrochen ist, da bringt der Postbote auf einmal ein Paket.
Und plötzlich steht ein länglicher Pappkarton auf dem Tisch, er ist leicht verbeult, bedruckt mit bunten Engeln und Sternen und sorgfältig mit einer Kordel verschnürt. Heraus wälzt sich, dick bestäubt mit Puderzucker und voll der getränkten Rumrosinen der fabelhafte Stollen. Er ist nicht zu hart und nicht zu weich, nicht zu süß und nicht zu einerlei, er schmeckt nach Advent und Tannenduft, nach heißem Grog und langen, dunklen Abenden im Kerzenschein. Er riecht nach stiller Süßigkeit. Er breitet sich aus, er wird immer größer, er scheint den ganzen Tisch zu bedecken, er wird bestimmt reichen, bis Weihnachten, bis Silvester, ja bis in den Januar hinein. Selbst wenn man ihn sofort anschneidet, umgehend Unmengen davon verzehrt,- man wird bis zum Sankt Nimmerleinstag genug davon haben.
Und dann freut er sich, der mit Stollen Beschenkte, der einsame Ruhrpottler im wintertrüben Wuppertal, der melancholische Saarländer an grau dahinfliessender Saar, der Wahlfranzose in der fernen Provence. Sie alle sind bewegt, sie weinen ein wenig und freuen sich, dass sie einen Dresdner kennen.
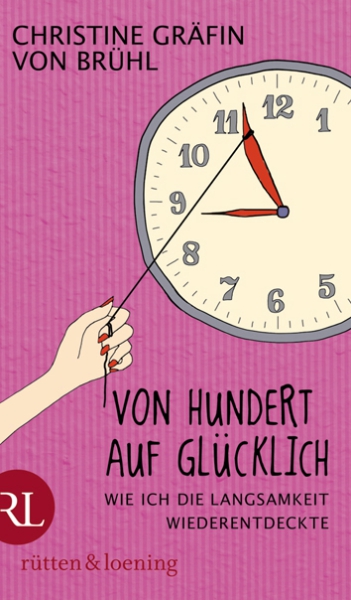
Von Hundert auf Glücklich. Wie ich die Langsamkeit wiederentdeckte.
rütten & loeningh, Berlin 2011.
Bestellen über Makrobooks
Christine von Brühl hat sich auf die Suche gemacht. Sie tritt auf dei Bremse und widersetzt sich in ihrem Selbstversuch der allgemeinen Hast. Sie nimmt weniger Termine an, checkt die E-Mails nur noch einmal am Tag und schaltet stunden-, bisweilen auch tagelang Telefon und Handy aus. Sie geht, isst, spricht langsamer. Und siehe da, es funktioniert!
Ich renne den Weg entlang zu dem Berliner Mietshaus, in dem sich mein Büro befindet, stemme mich gegen das hohe Eingangstor aus schwerem Holz und laufe durch die Einfahrt. Mein Rücken ist verspannt, die Stirn tief in Falten gelegt, der Nacken hart wie ein Brett. Ich bin in Kampfstimmung, noch bevor die Arbeit überhaupt begonnen hat. Durch mein Hirn rasen die Fakten, die ich in meiner Mail gleich aufzählen will. Meine Lippen formulieren lautlos das zweite Kapitel des Manuskripts, an dem ich gerade arbeite. Hinzu gesellt sich ein knurrender Magen. Wie immer bin ich dem Irrglauben erlegen, ein Frühstück könnte ich mir angesichts meiner angespannten beruflichen Situation nicht leisten. Mehr als zwei Tassen grünlich schimmernden Kräutertees habe ich mir in der Früh nicht gegönnt. Und das alles, obwohl kein Mensch kontrolliert, ob ich die Erste am Arbeitsplatz bin. Keiner prüft nach, wie viele Stunden und zu welcher Tageszeit ich meine Tätigkeit verrichte.
Bis in das Hinterhaus, in dem sich meine Arbeitswohnung befindet, sind es nur wenige Schritte. Ich laufe die Treppen hinauf, schließe die Tür auf, renne ins Büro und stelle den Laptop auf den Schreibtisch. Hektisch setze ich in der Küche Wasser auf, gehe zurück ins Arbeitszimmer, schalte das Licht ein und setze gleichzeitig Computer, Drucker und Faxgerät in Gang. Mit Getöse starten die Maschinen. Der gerade noch so stille Raum ist plötzlich lärmerfüllt. Kaum ist der Computer hochgefahren, habe ich in meinem Adressprogramm die Telefonnummer gefunden und greife auch schon zum Hörer. Inzwischen zittern meine Hände, so unterzuckert bin ich. Allein das Geräusch des Wassers, das angefangen hat zu kochen, hält mich davon ab, gleich die Nummer zu wählen. Ich gehe in die Küche und gieße mir erst einmal einen Kaffee auf. Der wird auch meinen Hunger stillen.
Warum muss ich eigentlich immer so rasen? Warum muss ich immer die Schnellste von allen, immer an vorderster Stelle sein? Selbst wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, fahre ich, nach Möglichkeit, so schnell ich kann. Eine Ampel, die auf Gelb schaltet, ist für mich eine glatte Herausforderung. Ich verlangsame mein Tempo nicht etwa und bremse allmählich ab, sondern trete erst recht in die Pedale. Ich möchte unbedingt noch über die Kreuzung kommen, bevor es Rot wird.
Woher kommt dieser Wahn? Ist es sinnloser Leistungsdruck? Eine Art Kampfstimmung, in die ich als Freiberuflerin unbewusst geraten bin? Ist es Existenzangst? Am Ende kommt die Anspannung gar nicht von außen, sondern ist eine Art innerer Gehorsam? Vielleicht habe ich es geerbt? Ein Teil meiner Familie hat im Zweiten Weltkrieg alles verloren und musste fliehen. Viele Flüchtlinge blieben ihr Leben lang der festen Überzeugung, ihr Geld würde prinzipiell nicht reichen, sie würden nie wieder auf einen grünen Zweig kommen. Entsprechend erzogen sie ihre Kinder. Steckt mir das vielleicht in den Knochen? Davon müsste man sich doch am allerleichtesten verabschieden können.
Leider ist es nicht nur ein individuell bestimmter, innerer Drang, der uns zur Schnelligkeit antreibt. Der Druck kommt von allen Seiten. Und er wächst täglich. Fast jeder hat heute ein Faxgerät, Internetzugang und mobile Telefone zur Verfügung, wir können schnell miteinander kommunizieren, von nahezu jedem Ort der Welt in Sekunden mit fast jedem anderen Ort der Welt Kontakt aufnehmen und uns mühelos über alles informieren. Wir können uns rasch von einer Stadt in die nächste bewegen, haben zuhause Gefrierschränke, Mikrowellen, Fernseher, Video- und DVD-Beamer – können schnell kochen, schnell essen, uns schnell und unmittelbar ablenken und vergnügen. All das dient einer enormen Zeitersparnis, und jeder von uns müsste jede Menge freie Zeit übrig haben, doch das Gegenteil ist der Fall. Wir kennen alles, nur keine Muße.
In der ersten Phase meines Selbstversuches habe ich mich bemüht, meine Mobilität generell einzuschränken. Ich bin langsamer Fahrrad gefahren, habe mich im Auto strikt an die gebotene Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten und auf der Autobahn nach Möglichkeit an ein Tempo von durchschnittlich hundert Stundenkilometern. Keiner muss der Erste am Ziel sein, bete ich mir leise vor, wenn ich abends gelegentlich in den Berufsverkehr gerate: Wir wollen alle nur nach Hause und dort sicher ankommen.
Da ich an Reisefieber kranke, störte mich meine eingeschränkte Mobilität nicht im Geringsten. Sie fiel mir sogar kaum auf. Auch wenn ich zu Fuß ging, habe ich mich bemüht, mein Tempo einzuschränken. Damit ich das in der täglichen Hektik nicht vergaß, baute ich mir bewusst kleine Hindernisse und Erinnerungen in den Alltag ein. Ich achtete darauf, auf dem morgendlichen Weg ins Büro jede Gehwegplatte einzeln zu betreten. Dazu musste ich den Blick senken, genau hinschauen, und mir fiel auf, wie unterschiedlich die einzelnen Platten aussahen. Sie sind, typisch für Berlin, aus grauem, glitzerndem Granit, eine lang und schmal, die nächste fast quadratisch. Von oben wirken sie glatt und einigermaßen eben, von unten hingegen hängen unbehauene, klobige Felsklötze daran. Jede Platte ist so unermesslich schwer, dass die Straßenarbeiter, wenn ein Rohr oder ein Kabel neu verlegt werden muss, ein eigens dazu erfundenes Werkzeug zum Einsatz bringen und wenigstens zu zweit sein müssen, um sie auch nur millimeterweise fortbewegen zu können. Von zwei Seiten packen sie den Stein mit einer überdimensionalen Eisenzange, stemmen ihn aus dem Boden und hieven ihn dann unter dem Einsatz der gesamten Körperkraft schrittweise zur Seite. Dort legen sie ihn vorsichtig ab.
Warum hat Berlin ein so tonnenschweres Pflaster? Die Granitplatten stammen aus Schweden. Sie waren das Ausgleichsgewicht für die Schiffe, die im 18. Jahrhundert Getreide in den Norden transportierten und leer über die Nord- und Ostsee zurückkehrten. Sicher und wohlbehalten im heimatlichen Hafen angekommen, wurden die schweren Steine abgeladen und die Schiffe wieder neu mit Roggen oder Weizen gefüllt. Die Steine waren praktisch ein Abfallprodukt und fanden in Form von Gehwegplatten eine sinnvolle Weiterverwendung. Nicht nur Berlins Bürgersteige wurden damit gepflastert, auch andere Orte und Städte im ehemals preußischen Umland erfreuen sich bis heute derart trittfester Wege – ein Zeichen für den schwunghaften Getreidehandel mit Skandinavien vor zweihundert Jahren.
Mit den Jahren haben sich die Platten unterschiedlich stark abgesenkt. Der Kanten, über die man stolpern kann, gibt es viele. Ich wusste, dass zwei Straßen weiter ganze Gehwegabschnitte gesperrt wurden, weil die Pflastersteine neu ausgerichtet werden mussten. Das gehört offensichtlich zum Berliner Alltag: Absperrungen und Umleitungen, nur weil jede Platte angehoben, mit Sand und Kiesel unterfüttert und wieder korrekt abgelegt, also der Gehweg begradigt werden muss. Wären die Platten von anderer Beschaffenheit gewesen, hätten sie sich womöglich nicht in so eigenwilliger Manier abgesenkt. Mir gefiel diese Unordentlichkeit. Ich begann, die Berliner Pflastersteine zu mögen.
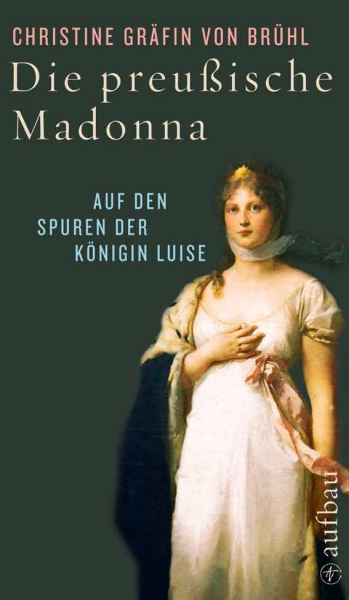
Die preußische Madonna. Auf den Spuren der Königin Luise.
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2010
Bestellen über den Aufbau Verlag
Geht man um das Anwesen herum, wird man des herrlichen Landschaftsgartens gewahr, der sich dahinter ausbreitet. Von der Anhöhe, auf der das Schloss steht, scheinen sich Wiesen- und Waldflächen in sanften Wellen stetig abwärts zu bewegen. An seinen Grenzen geht der Park nahezu ansatzlos in die Umgebung über. Es ist, als sei er ein Teil der Landschaft. Selbst die hellbraunen Kühe, die auf der Wiese weiden, scheinen zur Gartengestaltung zu gehören.
Sommerliche Hitze hängt wie schweres wollenes Tuch in der Luft. Wie immer reichen hier in der Gegend nur wenige niederschlagsarme Tage, um den Boden so auszudörren, dass er bei jedem Schritt vor Trockenheit raschelt. Weit sieht man von der Rückseite des Schlosses ins Mecklenburger Land hinaus. Kein Berg, keine Erhebung schränkt den Blick ein, kein Haus, keine Mauer, noch sonst ein höheres Gebäude bremst ihn. Wie ein Meer, erstarrt zu grünen Wiesen, Wäldern und braunen Ackerflächen, liegt das Land dem Betrachter zu Füßen. In der Ferne ist das Blau eines Sees zu erahnen.
Ähnlich heiß und sommerlich muss es im Juli vor zweihundert Jahren gewesen sein. Damals war Luise zu Besuch nach Mecklenburg gekommen, um sich hier nach entbehrungsreicher Zeit im Exil erstmals wieder mit ihrem Vater zu treffen. Drei lange Jahre hatte das preußische Königspaar auf der Flucht vor Napoleon in Königsberg und Memel verbracht. Luise hatte sich unheimlich auf das Wiedersehen gefreut: (Zitat) „Bester Päp! Ich bin tull und varucky. Eben hat mir der gute liebevolle König die Erlaubnis gegeben, zu Ihnen zu kommen, bester Vater!“, schreibt sie ihm, wie oft zitiert, am 19. Juni 1810. Ihre Briefe sind voller solcher eigentümlichen Wortschöpfungen und Lautverschiebungen, die charakteristisch waren für ihr lebhaftes, ungestümes Wesen.
Doch das Wiedersehen sollte kein freudiges bleiben. Wenige Tage nach dem feierlichen Empfang in der herrlich geschmückten Residenzstadt Neustrelitz verspürte Luise Kopfschmerzen und musste sich nach Hohenzieritz zurückziehen. Ihr Vater hatte ihr für die Zeit ihres Besuches seinen Sommersitz nördlich der Residenzstadt zur Verfügung gestellt. Am nächsten Morgen fieberte sie und blieb im Bett liegen. Die Erkältung verschlimmerte sich, bald war von einer Lungenentzündung die Rede, doch selbst als sich Brustkrämpfe einstellten, schlug niemand Alarm. Sie waren bei Luise schon öfter vorgekommen.
Die Königin hütete das Bett. Tagelang kam sie nicht auf die Beine. Draußen brütete die Julihitze. Oberhofmeisterin Sophie Gräfin von Voss (1729–1814), erste Hofdame der Königin, wurde hinzu gerufen. Sie hatte sich kurzzeitig auf ihren Familiensitz nach Groß Gievitz, unweit von Hohenzieritz, zurückgezogen. Die Oberhofmeisterin sorgte dafür, dass Luises Krankenlager ins Erdgeschoss verlegt wurde, weil es dort kühler war. Im Arbeitszimmer des Vaters wurde das Bett aufgestellt, gleich links vom Hauptportal.
Allein der König, Friedrich Wilhelm III. von Preußen (1770–1840), der in Charlottenburg seinen Staatsgeschäften nachging und in täglichen Bulletins über den Gesundheitszustand seiner Frau informiert wurde, war besorgt. Schließlich schickte er einen Berliner Arzt nach Hohenzieritz, den Sanitätsrat Ernst Ludwig Heim (1747–1834), der das Vertrauen der Familie genoss, doch Luises Zustand war inzwischen lebensbedrohlich geworden. Am 18. Juli stellte sich eine Herzembolie ein, die von Atemnot und schweren Erstickungsanfällen begleitet war. Per Eilbote wurde der König in Sanssouci benachrichtigt. Er übergab die Geschäfte seinem Staatsminister Karl August Graf von Hardenberg (1750–1822), nahm seine beiden ältesten Söhne, Kronprinz Friedrich sowie Wilhelm mit und eilte, so schnell ihn die Kutsche trug, nach Hohenzieritz. Ihm war klar, dass seine Frau schwer krank war, doch selbst er ahnte zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Luise im Sterben lag.
Gegen fünf Uhr früh erreichte die Kutsche das mecklenburgische Schloss. Der Morgen graute, der Himmel war noch nicht hell. Der König ging sofort in das Zimmer, in dem seine Frau lag, und erschrak, weil sie derart verändert aussah. Die schweren und anhaltenden Krämpfe hatten ihr das Äußerste an Kräften abverlangt.
Luise war nicht allein. Die Oberhofmeisterin stand an ihrem Bett, auch Dr. Heim war zugegen. Luises Vater war aus seiner Residenzstadt Neustrelitz gekommen, ebenso ihr Bruder Georg (1779–1860), zu dem sie ein enges Verhältnis hatte. Als Luise des Königs gewahr wurde, ging ein Leuchten über ihr Gesicht. Sie begrüßte ihn überschwänglich: „Lieber Freund, wie freue ich mich, dich zu sehen, gut, dass Du wieder da bist.“
Luise und Friedrich Wilhelm duzten sich. Schon wenige Tage nach ihrer Eheschließung hatten die beiden den preußischen Hof damit in Erstaunen versetzt, dass sie von der standesgemäßen Form der Anrede in dritter Person absahen. Sie brachen darin mit allen Konventionen. In den europäischen Herrscherhäusern siezten sich zu der Zeit selbst Geschwister untereinander.
Der König trat rasch an Luises Bett und erwiderte ihre Begrüßung. Sie fühlte sich erleichtert durch sein Kommen, fragte ihn nach seinem Befinden, nach dem Verlauf seiner Reise, doch er sah, dass ihre Kräfte schwanden. Keiner hatte ihr bislang gesagt, dass ihr Ende nahe sei. Er kniete sich an ihr Bett, nahm ihre Hand und fragte, ob sie noch einen letzten Wunsch habe. Sie verstand ihn erst nicht, wollte ihm darauf nicht antworten, rief nach einem anderen, der ihr die schlimme Nachricht bestätigen sollte, doch allmählich begriff sie: (Zitat) „Dein Glück und die Erziehung der Kinder“, antwortete sie schließlich. Er hielt weiter ihre Hand und hauchte in ihre Finger, um sie zu wärmen. Sie erwähnte Hardenberg, den Minister, dem sie am meisten vertraute. Er werde ihm zur Seite stehen, so hoffte sie für ihren Mann.
Der König ließ sie nicht mehr los, hielt ihre Finger während der nächsten Anfälle fest in beiden Händen. Auch Luises letzte Worte sind präzise überliefert: „Ich sterbe von oben herab … Ach Gott, verlass mich nicht.“ Schließlich rief sie: „Herr Jesus mach es kurz.“ Dann wurde sie erlöst. Der König selbst drückte ihr die Augen zu. Es war der frühe Morgen des 19. Juli 1810. Die Uhr im Zimmer schlug neun.
Die Autopsie würde später zeigen, dass Luises Lunge stark angegriffen war, der rechte Flügel von einem Tumor zerfressen. Hier kam jegliche Hilfe zu spät. Niemand hatte um ihren Zustand gewusst. Luise war erst vierunddreißig. Ihr Tod kam völlig überraschend.
Der König war wie gelähmt. Gemeinsam mit seinen Kindern ging er in den Garten. Auch Karl und Charlotte, die beiden jüngeren Geschwister, hatten inzwischen das Sterbelager ihrer Mutter erreicht. Sie suchten nach der Stelle, wo Luise sich zum letzten Mal draußen aufgehalten hatte. Bei der sommerlichen Teestunde Ende Juni hier auf ihrer Lieblingsbank musste Luise schon Kopfschmerzen verspürt haben. Die Kinder pflückten Blumen, Fritz, Wilhelm und Karl jeder für sich eine weiße Rose, Charlotte wand einen Kranz aus Rosen. Der König wählte eine Rose mit drei Knospen als Anspielung auf die drei jüngsten Kinder, die nicht zugegen waren: Alexandrine, Luise und Albrecht. Zehn Kinder hatte Luise insgesamt geboren, der Jüngste zählte bei ihrem Tod noch kein Jahr. Sieben erreichten das Erwachsenenalter, vier Jungen und drei Mädchen.
Ähnlich wie zu ihrem Mann, pflegte Luise auch eine innige Beziehung zu ihren Kindern. Die Mutter hatte sie in aller Öffentlichkeit umarmt und geküsst, sie hatte sie nach Möglichkeit jederzeit um sich haben wollen. Zahlreiche Abbildungen zeigen Luise beschäftigt mit einer häuslichen Tätigkeit, sitzend oder stehend im Kreis ihrer Kinder, auf Spaziergängen Hand in Hand mit den Kleinen oder im Garten, gemeinsam in ein Spiel vertieft. Auch dahingehend brach sie mit standesgemäßen Konventionen.
Umso schwerer fiel es den Kindern jetzt, den Tod ihrer Mutter zu begreifen. Jahrelang konnten sie sich nicht trösten. Der König versank in tiefe Melancholie. Dreißig Jahre würde er seine Frau überleben.
Während der König und seine Kinder versuchten, das Unfassbare zu begreifen, entwickelte sich um sie herum rastloses Treiben. Auch dem distanziertesten Beobachter musste in diesem Augenblick klar sein, dass Luises Tod die Chance für Preußen schlechthin war. Das Land hatte 1806 in den Schlachten von Jena und Auerstedt gegen Napoleon (1769–1821) beispiellose Niederlagen erlitten. In den nachfolgenden Friedensverhandlungen hatte es über die Hälfte seines Territoriums verloren. Die Regierung musste Reparationen in Höhe von 92 Millionen Talern an Frankreich zahlen. Als Ergebnis der Verhandlungen hätte Preußen auch ganz von der Landkarte verschwunden sein können. In diesen Zeiten der Demütigungen und Schwächung kam der Tod Luises gerade recht. Sie wurde als Opfer dargestellt, ihr Sterben als teuerster Tribut. Ein Volk vereint in der Trauer um seine geliebte Königin – nichts konnte wirkungsvoller sein, um im Land selbst Mut zu schöpfen und nach außen Zusammenhalt, Kraft und neues Selbstbewusstsein zu demonstrieren.
Eiligst wurde Hofbildhauer Christian Philipp Wolff gerufen. Er musste die Totenmaske abnehmen. Gleich anschließend wurde der Leichnam in essiggetränkte Tücher gewickelt. Nur eines hatte jetzt Priorität: Wie bleibt die Tote bei der sommerlichen Hitze möglichst lange Zeit unversehrt? Ein Staatsakt sollte zelebriert werden, ein Begräbnis, das an Dramatik alles zuvor Gewesene überbot. So viele Menschen wie möglich sollten Gelegenheit bekommen, Luise noch einmal zu sehen. In Hohenzieritz sollte der Trauerzug beginnen, durch die Städte und Dörfer am Rande der Straße verlaufen, bis nach Berlin. Dort würde daraus längst ein Triumphzug geworden sein.
Fieberhaft wurde das Reglement zur Überführung der Leiche zusammengestellt. Eine pechschwarze Kutsche musste es sein, die den Sarg transportierte, rabenschwarze Pferde wurden davor gespannt.
Zehn herzoglich-strelitzsche Kammerherren hatten am 25. Juli 1810 um zwei Uhr früh vor Schloss Hohenzieritz bereitzustehen. Sie hoben den Sarg auf den königlichen Leichenwagen und gaben der Königin bis zur preußischen Landesgrenze das Geleit. Gleich hinter dem Leichenwagen folgte die königliche Kutsche. Da Friedrich Wilhelm mit den Kindern schon nach Berlin vorausgefahren war, saß darin tiefverschleiert nur eine einzige Person: Ihre treue Oberhofmeisterin Sophie Voss, die später über den Trauerzug berichtete: „Was ich in diesen drei Tagen gelitten habe, kann kein menschliches Wort sagen.“
Zwei königliche Stallmeister zu Pferd begleiteten zusätzlich die Equipage. Allen Beteiligten war gleichermaßen unwohl und beklommen zumute. (Zitat) „Die feierliche Stille, der schöne friedliche Morgen – alles voller Andacht, Thränen und Schmerz. Nicht eine Königin beweinte man: Eine gute große edle Frau.“
Langsam setzte sich der Zug in Bewegung, nur im Schritttempo ging es voran, drei Tage würde er dauern, über eine präzise festgelegte Strecke führen. Am ersten Tag ging es über Weisdin, Fürstensee, Fürstenberg, Dannenwalde bis nach Gransee, am zweiten Richtung Oranienburg. Möglichst durch den Wald sollte der Leichenwagen fahren oder über Straßen, die von Bäumen gesäumt waren, damit der Sarg nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt war. (Zitat) „Der Kühlung halber war ein eigener Weg durch den Wald gelichtet worden (…). Der mit Sammet behangene Sarg schwebte in einem mit Stahlfedern versehenen Gestelle und die Seitenwände, gegen welche er durch das Rütteln des Fahrens anstoßen konnte, waren mit Matratzen ausgepolstert.“
Die Inszenierung gelang. Alle Kirchenglocken läuteten, die Menschen standen Spalier, jeder trug Trauerflor, selbst die Ärmsten. Kein Ton war zu hören, nur das Schnauben der Pferde, das Knarren der Wagen und Räder. Niemand sprach. Schweigend nahmen die Leute Abschied von ihrer Königin. Eine Prozession von entsetzlicher Traurigkeit.
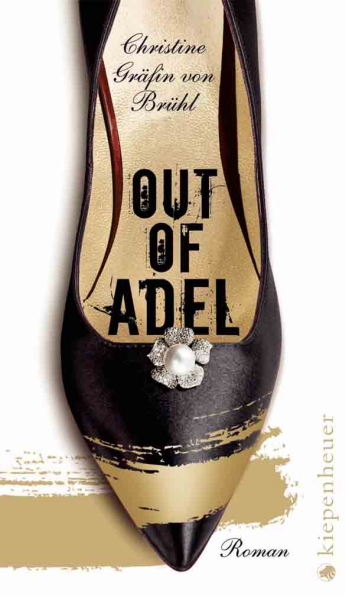
Out of Adel
Gustav Kiepenheuer, Berlin 2009.
Bestellen über Makrobooks / ebook
Obwohl sich seine Hand also in unauflöslicher Eintracht mit der linken Schulterklappe seiner Lederjacke befand, als er mir plötzlich gegenüberstand, gelang es ihm, mir die wenig originelle Frage zu stellen: »Haben wir uns nicht irgendwo schon einmal gesehen?«
Jeder weiß, dass es kaum eine Frage gibt, die ungeeigneter wäre, eine Frau näher kennenzulernen, die man eben noch nie zuvor in seinem Leben gesehen hat. So blöd sind Frauen nicht, als dass sie nicht wüssten, dass ihr männliches Gegenüber in diesem Moment nicht die Wahrheit spricht. Zudem war ich abgelenkt, stand gewissermaßen unter Strom,
doch weniger wegen des attraktiven Mannes, der da vor mir stand. Wer bei der Zeitung arbeitet, ob als Fotograf oder Autor, steht zwangsläufig unter Druck, und sei es auch nuraus zeitlichen Gründen. Ich hatte von zeitgenössischer Kunst wenig Ahnung und musste aufpassen wie ein Spitz, um wenigstens ein Quäntchen von dem zu verstehen, worüber ich später einen Artikel schreiben sollte. Ich antwortete ausweichend: »Möglicherweise aus den Augenwinkeln.«
Dabei hatte ich das Bild vor Augen, das mich regelmäßig des Nachts heimsuchte, wenn ich abends kurz vor dem Schlafengehen noch rasch in eine Dresdner Neustadtkneipeging, um dort ein Glas Wein zu trinken und bald darauf eiligst die Horizontale aufzusuchen. Journalisten mussten im Osten früh aufstehen. In der Kulturredaktion der Sächsischen Zeitung fand morgens um neun Uhr die erste Besprechung statt, und man durfte keinesfalls zu spät kommen, schon gar nicht als Westdeutsche. Die galten als notorische Langschläfer.
Bei diesen Gelegenheiten, abends in der »Planwirtschaft« oder im »Raskolnikoff«, sah ich sie rechts und links an den Tischen sitzen, die schwarzen Raben in ihrer schweren Lederkluft,sah die kahl geschorenen Köpfe, die markanten Gesichter und scannte die dazugehörigen jungen Männer rasch aus den Augenwinkeln, um unauffällig herauszufinden, ob ich einen von ihnen kannte. Cool musste man dabei sein, total abgeklärt, mit komplett versteinertem Gesicht vorgehen, denn gerade solchen Neustadt-Typen durfte man keinesfalls zeigen, dass man auch nur das geringste Interesse an ihnen hatte. Wer als Frau seine Neugier nicht verbergen konnte, hatte schon Schwäche gezeigt, und das wird von Männern – im Osten wie im Westen – bekanntlich postwendend ausgenutzt.War das also einer von diesen schwarzledernen Typen aus der Neustadt, der da vor mir stand? Und den ich jetzt sagen hörte: »Ja, genau diese Augenwinkel habe ich schon einmal irgendwo gesehen.« Ich blickte überrascht von meinem Notizblock auf. Einer von diesen kahlköpfigen Raben, die sich alle so dermaßen fabelhaft vorkamen, dass man sie lieber gar nicht ansprach, konnte charmant sein? Und warum hielt er sich mit der rechten Hand an der linken Schulter fest? Ich lachte, und mir fiel tatsächlich nichts Besseres ein, als zu sagen: »Na ja, vielleicht im Raskolnikoff, oder so.«
Das war’s. Bis hierhin und nicht weiter. Nicht einmal unsere Vornamen tauschten wir aus, geschweige denn Adressen. Eine Telefonnummer wäre sowieso nutzlos gewesen. Schließlich hatte kaum jemand einen Anschluss. Nichts, gar nichts. Schrat hatte in seiner Feinfühligkeit längst gemerkt, dass ich hektisch gestimmt und beschäftigt war. Außerdem fühlte er sich in gewisser Weise eingeschränkt durch seine angeklebten Fingerspitzen. Selbst wenn er gewollt hätte, er wäre gar nicht in der Lage gewesen, einen Namen aufzuschreiben.
Aber ich wusste immerhin, in welche Kneipe er zu gehen pflegte. Wollte ich den schwarzen Raben wiedersehen, dachte ich, als ich ins Auto stieg, um eiligst über die Autobahn zurück nach Dresden und in die Redaktion zu rasen, dann würde ich genau in dieses Etablissement in der Böhmischen Straße marschieren müssen. Dort schien er Abend für Abend zu sitzen.
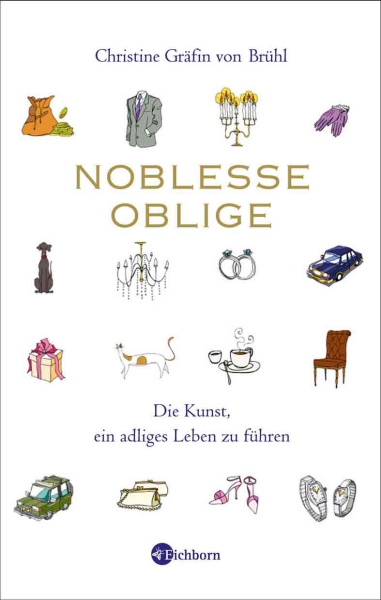
Noblesse Oblige. Die Kunst, ein adliges Leben zu führen.
© Eichborn AG, Frankfurt am Main, März 2009.
Bestellen über Makrobooks / ebook
Nun ist man ja im reifen Alter von 15 Jahren nicht unbedingt so souverän, auf solch frotzelnde Bemerkungen von Erwachsenen immer die richtige Antwort zu haben. Immerhin war meine Schwester so schlagfertig, mit ihrem Meister und seiner Frau, die ansonsten ausgesprochen nette Menschen sind und das Herz unbedingt auf dem rechten Fleck haben, eine Wette abzuschließen. Sie würde garantiert keinen Adligen heiraten, das sei ihr alles zu dumm. Dafür müssten die beiden Gärtnersleute ihr nach der Hochzeit aber eine Flasche Champagner spendieren. Sollte sie wider Erwarten doch einem Grafen, Fürsten oder Prinzen in die Fänge geraten, würde sie selbst eine Flasche ausgeben.
Bei mir war die Sachlage ein wenig anders. Ich dachte, ich müsste einen Adligen heiraten, ich käme sozusagen nicht darum herum. Schließlich wird man als Adlige so erzogen. Keiner heirate gefälligst unter seinem Stand. Man hat auch nach Möglichkeit nur adlige Freunde, geht nur mit Adligen aus und korrespondiert ausschließlich mit Adligen. Natürlich gibt es auch andere Menschen, Bürgerliche sozusagen, aber mit denen hat man höchstens Umgang, man grüßt freundlich, spricht ein paar Takte miteinander, wahre Freundschaften jedoch werden nur mit Adligen geschlossen. So die Erziehung.
Die Wirklichkeit war und ist ein wenig anders. Ich ging auf ein gewöhnliches städtisches Gymnasium. Da gab es außer mir keinen einzigen Adligen und wenn, dann hielten sie sich ähnlich gut versteckt wie ich. Meine Freunde waren alle bürgerlich, und ich musste meine Parallelwelt gut tarnen. Wenn man mich nach meinem Namen fragte, ließ ich das „von und zu“, was gemeinhin zu adligen Nachnamen gehört, weg, und wenn eine meiner Freundinnen ihren Besuch ankündigte, versteckte ich tunlichst alle Hinweise auf meine komische Abstammung.
Ich bewunderte meine Schwester für ihre Kühnheit, sie war schon immer mutiger als ich. Sie konnte vor mir Rollschuh laufen, Fahrrad fahren, ja sogar den Freischwimmer absolvierte sie noch kurz vor mir. Eine Gärtnerlehre ist in adeligen Kreisen auch nicht gerade üblich. Aber was Verlobung und Eheschließung anging, so glaubte ich niemals, dass sie sich durchsetzen würde. Schließlich war auch sie eine Adlige und würde genau wie ich standesgemäß heiraten müssen.
Bei den Adligen heißt es, eine Ehe mit einem Bürgerlichen sei unaufhaltsam dem Untergang geweiht. Mit einem bürgerlichen Ehemann werde man auf Dauer nicht glücklich. Das sei keine Basis, und Ehen ohne Basis hätten keine Überlebenschancen. Die seien ja womöglich nur aus Liebe geschlossen worden. Und nichts sei so gefährlich wie die Liebe. Sie sei romantisch, aber unrealistisch.
Meiner Schwester war das alles schnurzegal. Sie verliebte sich kurzerhand in einen Bürgerlichen und behauptete, dies sei der schlagende Beweis: Niemals würde sie einen Adligen heiraten. Nicht dass sie diesen ersten Bürgerlichen gleich geheiratet hätte, aber sie behauptete steif und fest, sie könne sich gar nicht erst in einen Mann mit Titel verlieben. Die seien doch so uninteressant und langweilig. Ich widersprach ihr nicht – was zählen bei einer frisch Verliebten schon Argumente, und manche Adlige sind in der Tat schon als junge Menschen ziemlich langweilig. Aber insgeheim dachte ich mir, sie werde damit nicht durchkommen. Liebe hat in den Augen Adliger schließlich nichts mit Ehe zu tun, also zählt sie auch nicht als Beweis.
Am besten ist in den Augen der Adligen die sogenannte „gesteckte“ Ehe, wie schon meine Großmutter es nannte: eine Ehe zwischen zwei Menschen, die bewusst und mit Absicht zusammengeführt werden, eine Ehe, die praktisch am Grünen Tisch geplant, verhandelt, beschlossen und, um es in der Terminologie der Adelswelt auszudrücken, aus dem Gotha gesucht worden ist. Der Gotha, das Genealogische Handbuch des Adels, ist die eigentliche Bibel der Adligen. Im Grunde ist es ein Stammbuch, ein Verzeichnis sämtlicher adliger Familien und ihrer Abstammungen. Es gibt, insgesamt gesehen, nicht sehr viele Adlige, jedenfalls nicht viele Adlige, die immer alles richtig gemacht haben, da musste sich schon einer die Mühe machen und sie alle einmal auflisten. Erst dann konnte man sagen, wer alles dazugehört, und wer vor allem nicht dazugehört, auch wenn er es noch so standfest behauptet.
Abgesehen von fleißiger Gotha-Lektüre gibt es weitere Maßnahmen, die der Adlige traditionsgemäß ergreift, damit die Heranwachsenden sich gegenseitig kennenlernen und ja nicht nur Umgang mit Bürgerlichen haben. Man lädt zum Faschingsfest mit Polonaise durchs ganze Haus, zur gemeinsamen Fahrradtour, zum Sommerball oder zur Jagd ein. Ein Jagdschein ist unter Adligen, insbesondere der männlichen Sorte, nahezu eine Selbstverständlichkeit. Wer ihn ablehnt, legt, ähnlich wie ein Wehrdienstverweigerer, ein politisches Statement ab. Für die berühmten Feste muss man tanzen lernen: Walzer, Foxtrott, Rock and Roll, meinetwegen auch Tango – das sollte jedem Adligen früher oder später ins gewissermaßen blaue Blut übergegangen sein. Ein Adliger, der nicht tanzen kann, hat ein Problem.
Auch meine Schwester und ich wurden zu solchen Fahrradtouren, Tanzkursen und kleineren oder größeren Festen eingeladen. Das einzige Problem daran sind die Einladungen, denn Adlige laden immer schriftlich, per Post und in vollendeter Form ein. Die entsprechenden Karten werden in standesgemäßer Schrift gedruckt. (Es gibt in der Tat eine ganz bestimmte Druckschrift, die alle Adligen auf ihren Anzeigen und Einladungen verwenden und an der man ihre Zuschriften schon von weitem erkennt). Sie enthalten den Anlass des Festes, den Namen des Gastgebers mit allen Von und Zus und Übers und Unters und führen vor allem aber auch in vollem Umfang den Namen des Eingeladenen auf.
Genau das wird es zuweilen kompliziert. Wer auf ein gewöhnliches städtisches oder ländliches Gymnasium geht, ist seinen Mitschülern sicher mit Vornamen und unter Umständen auch mit Nachnamen gut bekannt. Doch jeder jugendliche Adlige wird es um Himmels willen vermeiden, das Von, den Baron oder gar die Gräfin hinzuzufügen, die in seinem Pass stehen, ja, er wird hoffen, dass die meisten in seiner Klasse gar nicht mitbekommen haben, dass er so heißt, dass die Person, die sich hinter einem gewöhnlichen Vornamen wie Christine, Friedrich oder Maximilian verbirgt, in Wahrheit ein echter Graf oder eine echte Gräfin ist. Was tun, wenn nun einer der Mitschüler zu Besuch kommt, womöglich unangemeldet, und an der Korkwand pinnt die Einladung zum nächsten Sommerball von Onkel Prinz und Tante Prinzessin Soundso anlässlich des Geburtstages ihrer Tochter?
Es gibt wohl keinen jugendlichen Adligen, bei dem in so einer Situation nicht der Angstschweiß aus allen Poren bricht und der nicht zu seiner Pinnwand rennt und diese Einladungen, die neben dem Stundenplan, der Telefonliste, den Trainingsangaben zur nächsten Tennis- oder Reitstunde und irgendwelchen Urlaubspostkarten hängen, so schnell wie möglich herunterreißt. Denn niemand kann sich vorstellen, in welches Hohngelächter eine Schulklasse in besagtem städtischen Gymnasium ausbrechen würde, wenn sie am nächsten Tag zu hören kriegt, dass einer ihre Mitschüler bei Prinzens zum Sommerball eingeladen ist.
Und es sind nicht nur die Schüler, es sind auch viele Lehrer, die spöttische Bemerkung über den Adel fallen lassen, es sind die Kumpel vom Sport, die damit nicht umgehen können, es sind später auch die Kommilitonen, es ist am Ende die ganze Welt, die einem Adligen mit Spott, Unwillen, zumindest Befremden begegnet. Jedenfalls kommt einem das als Jugendliche so vor.
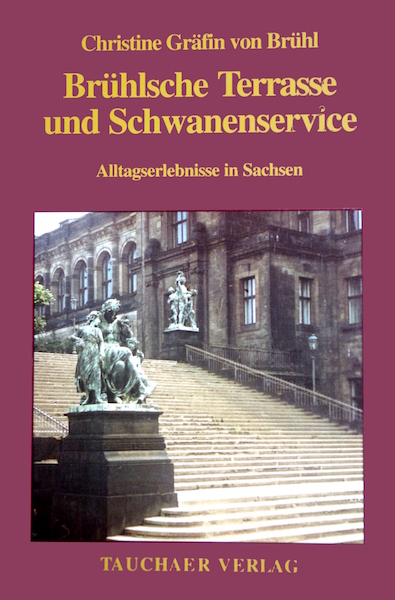
Brühlsche Terrasse und Schwanenservice.
Alltagserlebnisse in Sachsen
© Tauchaer Verlag, Taucha 1996.